
Superkräfte – Welche Magie braucht unsere Welt?
Texte:
Illustration: Nora Kraska
Prolog: Alexandra Zenleser
Redaktion: Alexandra Zenleser
Magier:innen verzaubern uns mit ihren übersinnlichen Tricks und Illusionen. Superheld:innen faszinieren uns mit ihren übernatürlichen Fähigkeiten, die uns Menschen vor bösen Kräften und Gefahren retten können. Übermenschliche Kräfte können jedoch auch unheimlich erscheinen. So galten Hexen als Außenseiterinnen der Gesellschaft, was bis zur Verfolgung und Gewalt an ihren Körpern führte. Magie hatte und hat vermutlich nicht immer Platz in unserer sehr rational geprägten Sichtweise.
Wenn Du eine Superkraft wählen könntest, welche wäre das?
Fliegen? Unverwundbarkeit? Oder vielleicht etwas ganz Unscheinbares? Denn müssen Superkräfte und Magie, außerhalb ihrer Definition, zwingend übermenschlich sein? Oder können menschliche Handlungen und Konzepte wie Solidarität und Gemeinschaft ebenfalls Magie schaffen und sich ganz natürlicher Sinne bedienen? Verbundenheit kann Zuversicht spenden. Grenzenlose Vorstellungskraft macht scheinbar Unerreichbares möglich. Auch Hexen versuchten sich durch eine menschliche Kraft von der Gewalt an ihnen zu befreien. Kein Zaubertrunk, keine Unsterblichkeit, keine Hexerei, sondern das konsequente Festhalten an ihrer Existenz. Widerstand als Superkraft!
Ist Magie eine Frage von Perspektive? Von Kultur oder Glauben? Müssen Fähigkeiten erst unerklärlich sein, um als Superkraft oder Magie zu gelten? Auf einen magischen Ausflug in ihre Gedanken nehmen unsere Autor:innen, Eva Cathrin Scholl, Matthias Straub und Kata Bachmann uns in dieser Ausgabe mit.

„Entunterwerfung“ statt Entzauberung?
Yes, please!
Ob magische Wesen aus Fabeln oder die Marvel-Superheld:innen: Hexen, Drachen, Magier:innen und Superhelden haben mein aufwachsendes Ich begleitet. Sie haben mir ermöglicht, einen Zugang zur Welt erschaffen, der außerhalb nerviger Hausaufgaben, präpubertärer Konflikte und des Alltags eines provinziellen Stadtteils am Rande von Köln lag. Meine Vorbilder entsprangen Comics und Fernsehserien. Besonders die animierte Serie Simsalabim Sabrina, die ich damals rauf- und runterschaute, faszinierte mich. Die Serie handelt von Sabrina, einer zwölfjährigen Halb-Hexe, die sich im Spannungsfeld ihrer magischen Superkräfte und den Problemen einer heranwachsenden Mittelschülerin in der Welt der „Sterblichen“ bewegt. Vermutlich mochte ich Sabrina damals so gerne, weil sie für mich ein greifbarer Charakter war: Sie war einerseits ein Mädchen mit übersinnlichen Kräften und andererseits erinnerte sie mich als adoleszentes Individuum an mich selbst.
Je älter ich wurde, desto mehr verlor ich das Interesse an Sabrina und Co. Erst im universitären Kontext begegnete ich den Hexen erneut, besonders in Verbindung mit materialistisch-feministischen Strömungen. Beispielsweise durch die Forschung von Philosophin und Aktivistin Silvia Federici setzte ich mich aus einer anderen Perspektive mit Hexen auseinander. Zum ersten Mal wurde mir die an den Hexen verübte Gewalt, die sich im Zuge der fortschreitenden Rationalisierung der Welt vollzog, bewusst. Ich erfuhr, dass Hexen als Ehebrecherinnen oder promiskuitive Frauen verfolgt und marginalisiert wurden, dass ihr Wissen über den weiblichen Körper und dessen Reproduktion enteignet und kriminalisiert wurde. Die Magie erschien im Zeitalter des Übergangs zum Kapitalismus als Arbeitsverweigerung und war eine Bedrohung für die Nutzbarmachung von Körpern. Die Hexen wurden also gezielt verfolgt und gejagt. Mit Wut und Trauer begegnete ich den Erzählungen über die verübte Gewalt an den Hexen.
Gleichzeitig faszinierte mich ihr Widerstand gegen die grauenhafte Verfolgung: Die Hexen widersetzten sich vehement der Machtübernahme ihrer Körper und Lebensweise. Ihr Widerstand bestand im nachdrücklichen Festhalten an der eigenen Existenzweise, im Abwenden von den neuen Machtstrukturen, die die Prozesse der Rationalisierung und Naturbeherrschung mit sich brachten.
Ich denke, dass es diese Form des Widerstandes ist, die mich an den Hexen begeistert. Sie ist für mich die „wahre Magie“ oder „Superkraft“ der Hexen. Jene Art des Widerstandes regt mich zum Nachdenken an: Es handelt sich hier um eine alternative Form der Selbstorganisation, die wir auch in unsere modernen Lebensweisen miteinbeziehen könnten. Diese Form der Selbstorganisation begründet sich im Rückzug oder im Akt des Sich-Abwendens. Sind wir in einen Konflikt verwickelt, sei es ein politischer, sozialer oder auch ein räumlicher, bekommen wir schnell das Gefühl, wir müssten jederzeit aktiv am Konfliktgeschehen teilhaben. Aber warum sollte es nicht genau so wichtig sein, sich von einer Situation oder einem Konflikt abzuwenden oder loszulösen?
In meinem letzten Artikel für GUESTBOOK skizzierte ich das Spannungsfeld meines Familiensystems im Verhältnis zum Erlangen von Autonomie. Ich verhandelte die Problematik von Nähe und Distanz. Als Lösungsansatz habe ich die Konfrontation als die notwendige Bedingung des In-Kontakt-Tretens charakterisiert.
Es ist eben nicht selbstverständlich, aktiv an einem Konflikt teilzunehmen. Es ist ein Privileg. Daher sind es Empathie, Sensibilität und Sorge, die dem Konflikt vorausgehen. Aus diesem Grund müssen wir, angelehnt an die Praktiken der Hexen, subversive Formen des Widerstandes in Betracht ziehen, bei denen jeder Körper die Möglichkeit einer Partizipation bekommt.
Text: Eva Cathrin Scholl
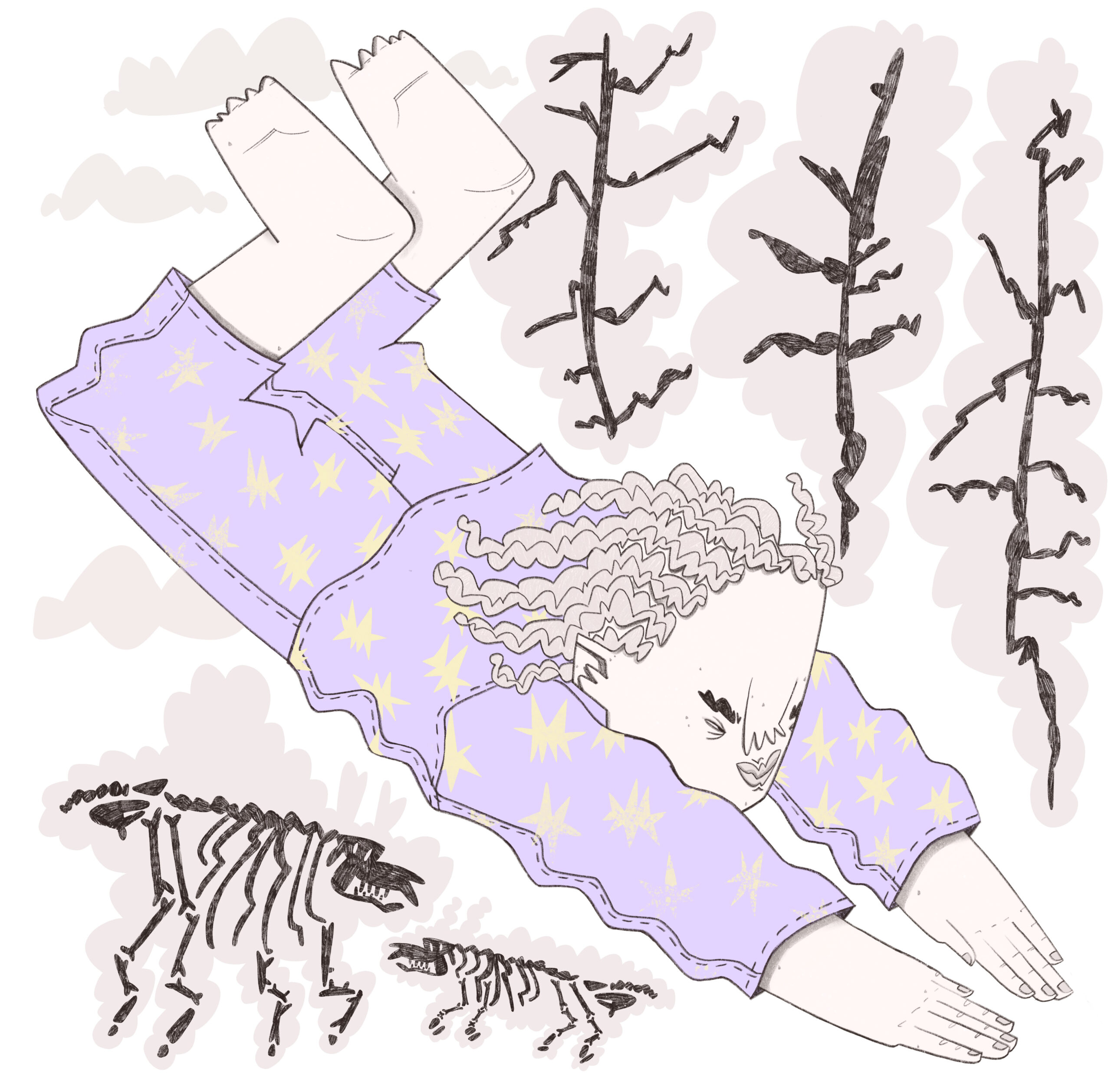
Welche Superkräfte braucht die Welt?
Eine Überlegung von Matthias Straub
„Would you rather …?“ Dieses amerikanische Imaginationsspiel kommt mir in den Sinn, als mich mein zwölfjähriger Sohn fragt, ob ich lieber fliegen oder unter Wasser atmen können würde.
Ich überlege. Natürlich habe auch ich mir als Kind immer vorgestellt, wie ich im Freibad alle anderen im Luftanhalten besiegen würde. Oder wie ich im Urlaub einfach ohne Schnorchel im Meer unter Wasser den bunten Fischen nachjage, ohne auftauchen zu müssen – weil ich ja unter Wasser atmen kann!
Außerdem hatte ich wie viele andere Menschen auch immer wieder im Traum Panik, weil ich ins Wasser stürze und zu ertrinken drohe. Dabei bemerke ich aber auf einmal, dass ich gar nicht in Gefahr bin: Ich muss nicht ertrinken, weil ich unter Wasser meine Lungen wie gewohnt mit Luft füllen kann. Eine in der Tat sehr reizvolle Vorstellung.
Aber dann kommt mir wieder in den Sinn, wie ich vielleicht in genau denselben Träumen – oder auch in anderen – von einem Haus oder einer Klippe springe, meine Arme ausbreite und einfach davonfliege. Dieses erträumte Gefühl von Freiheit und der erhabenen Vorstellung eine andere, ganz neue Perspektive einnehmen zu können, überragt die Fähigkeit unter Wasser die Luft nicht anhalten zu müssen bei Weitem!
Dabei halte ich es wie Michael Ende, der dieses Gefühl in seinem Gedicht „Der Traum vom Fliegen“ so beschrieben hat:
Du fliegst und du fliegst und du brauchst kein Ziel
Das Dasein selbst ist Glück!
Keine Grenze dort unten bekümmert dich viel,
du möchtest nie zurück.
Kein Ziel haben zu müssen, einfach nur um des Fliegens Willen ohne das Klima mit Emissionen zu belasten in der Luft sein zu dürfen, nur „zu sein“ ohne etwas darstellen zu wollen, keine Grenzen zu kennen und ohne Einschränkungen Neues kennenlernen zu können erschien ihm das größte Glück. Das fühle ich.
Und so steckt hinter der erdachten Superkraft fliegen zu können, vielleicht eine noch kraftvollere Fähigkeit, die der Welt und den Menschen Hoffnung schenken kann: Nämlich sich wieder wie ein Kind die eigene Realität erträumen zu können.
Text: Matthias Straub

Zuversicht
I
Wir haben den teppich hier ausgerollt, wir haben das muster gewebt und es davor auf einem screen
Entworfen. mit unseren glänzenden fußspitzen haben wir einen
Kreis gemalt in den nachgiebigen stoff. wir
Gehen jetzt. sollten Sie im laufe der woche feststellen, dass sich der teppich
Dem grundriss nicht fügt. rufen Sie an.
II
Es kleben mir krümel an den sohlen. Davon komm ich nicht weg. Weißt du wohin?
Es liegen da äpfel mit bissspuren in der schale. und abgekaute fingernägel in den ecken. unter den stoffen.
Ich trage das mit mir
–
Wir sind die steine geschliffen vom wasser
Liegen sanft in der luft. Ihr könnt
Uns nicht fassen. unterscheidet uns nicht.
III
Rechne mir aus mit dir malend
Deine haare sehe dich schon – meine im wind. Wie lang hast du gewartet?
Du hast mich geküsst so leicht ich merkte es kaum.
Text: Kata Bachmann

Das Phänomen der weißen Sneaker
Texte:
Illustration: Melissa Cagatay
Prolog: Alexandra Zenleser
Redaktion: Alexandra Zenleser
Der Blick ins eigene Schuhregal, vor die Eingangstüren zahlreicher WGs oder beim mittlerweile seltenen Gang ins Office zeigt: Weiße Sneaker sind als Alltagsphänomen nicht mehr wegzudenken!
Es ist erstaunlich, was hinter so einem Paar Sneaker verborgen liegen kann. Bei Willy Iffland waren es bereits genau diese weißen Sneaker, die eine große Leidenschaft für Mode und die Sneakerszene entfacht haben. Der Air Force 1 war dann nicht nur ein Schuh, den man sich vom Taschengeld noch nicht leisten konnte, sondern ein Sinnbild der Hip Hop Ära, die Verbindung zum eigenen Teenie-Idol und der Ausdruck von Zugehörigkeit. Geht man von den 90ern weit zurück in die 40er Jahre, ist im Beitrag von Katja Wanke zu lesen, so konnten weiße Sneaker eine Emanzipation von alten Normen, schon beinahe eine Entfesselung vom System verkörpern.
Mittlerweile sind die weißen Sneaker für viele sicherlich nur einfach Schuhe. Simpel zu kombinieren, die zu allem passen und in jeder Form und Preisklasse zu finden sind. Dennoch bleibt nicht aus, dass der weiße Sneaker immer auch ein gewissen Lebensstil signalisiert. Die Farbe Weiß steht für Reinheit – zumindest bevor es das erste Mal regnet, wenn man die neuen Schuhe trägt. Er könnte, so schlicht er auch daherkommen mag, sogar als glänzendes Statussymbol der westlichen Kultur verstanden werden. Aber ist er wirklich so rein voll allen Schattenseiten, wie es Francesca-Romana Audretsch in ihrem Beitrag thematisiert? Strahlt er vielleicht doch nicht so weiß? Man könnte fast meinen, dass die Menschen heute so sehr nach Selbsterfüllung und Individualität streben, dass sie glücklich darüber zu sein scheinen, sich auch einfach mal wieder im kollektiven Einheitsbrei ausruhen zu dürfen. Selbst wenn man wie Paula Thomaka zu dem Fazit kommt, dass einem weiße Sneaker einfach völlig egal sind, haben doch alle irgendwie eine Meinung dazu. Ein paar Schuhe wie ein Phänomen, das sich nicht klar definieren lässt – aber mit Sicherheit wahrzunehmen ist.

In den Sneakern meiner Großmutter
Meine Oma ist eine Fashionista. Sechs Quadratmeter rustikale Eiche mit goldenen Knäufen, vollgepackt mit Schätzen aus fünf Jahrzehnten, sind der Beweis. Heute erlebe ich meinen persönlichen Narnia-Moment zwischen ihren Kleiderbügeln. Ich schlinge und winde mich durch Seide und Kaschmir, kämpfe mich an Polyester und Leder vorbei, verheddere mich in einem Schulterpolster und stoße unversehens auf einen Schatz: Ein Paar weiße Reebok Classics, Größe achtunddreißig. Ich suche Augenkontakt. Meine Oma nickt mir gutmütig zu und mir ist klar, dass diese Sneaker soeben ihre Besitzerin gewechselt haben.
Drei Stunden „Behalten oder Spenden“-Fragen später, nach denen mir Marie Kondo bestimmt mütterlich die Schulter getätschelt hätte, lädt mich meine Oma ins Café ein. Ich blicke auf 77 Jahre geballte Modeerfahrung, die auf dem Stuhl gegenüber genüsslich an einem Americano nippt. Unter dem Tisch grinsen mich meine neuen Schuhe an und ich frage meine Oma, ob sie noch weiß, wie das „Weiße-Sneaker-Phänomen“ in ihrer Generation eingeläutet wurde.
Erinnern kann sie sich nicht. Sie waren plötzlich da. Meine Oma meint, weiße Sneaker gehen für sie Hand in Hand mit einer Gesellschaft, die langsam aber sicher die Fesseln ihres strengen Elternhauses ablegt. Als meine Oma die Schule beendet hat, waren weiße Sneaker noch nicht „salonfähig“. Zitat: „Wie können Sie es wagen, sonntags Schuhe ohne Absatz zu tragen?“ Man möge sich vorstellen, dass sich die Frauen in den 40er Jahren in unbequeme Heels zwängen mussten, um auf der Tanzfläche einen ordentlichen Boogie Woogie hinlegen zu können.
Meine Freunde würden den Begriff Hallux wahrscheinlich mit einem coolen Tech-Start-up assoziieren. Doch eigentlich handelt es sich dabei um eine schmerzhafte Fehlstellung am Mittelfußknochen, die meiner Oma oft Schmerzen bereitet. Hallux entsteht häufig durch zu enge Schuhe mit hohen Absätzen. Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und behaupte, dass dieses Problem mit den Boomern, der Gen-X und der Gen-Y rapide zurückgegangen ist. Fast wirkt es so, als hätte jemand in den 50er Jahren einmal laut „JETZT MACHEN WIR UNS ALLE MAL EIN BISSCHEN LOCKER!“ gerufen, und die Fashion-Welt hätte aufgeatmet und ihre Salonschleicher tief in die Kleiderschränke verbannt und ihnen einen zusätzlichen Tritt zum Abschied verpasst.
Sind weiße Sneaker dann ein Sinnbild von Rebellion? Von Emanzipation? Von Tabubruch? Ich lache laut auf, denn ich merke, wie komisch das klingt. Meine Oma lacht nicht. Sie erklärt mir, dass jede Generation alte Konventionen hinterfragt und neue Standards normalisiert. So wären Freizeitschuhe vor dem Traualtar in den 40er Jahren ein waschechter Skandal gewesen. Heute ist es das normalste der Welt. Weiße Sneaker wirken so herrlich unkompliziert in einer Zeit, die an Komplexität wohl nicht zu überbieten ist. Alle Möchtegern-Kritikern, die sich mit dem Phänomen weiße Sneaker um eine schwindende Individualität unserer sonst so bunten Gesellschaft sorgen, würde ich deshalb gerne fragen: Ist es denn so falsch, der Sehnsucht nach Unkompliziertheit nachzugeben? Ich bin vom Gegenteil überzeugt. Meine Oma übrigens aus.
Sie bezahlt die Rechnung und wir stehen auf. Beim Hinausgehen fällt mein Blick erneut auf meine Reeboks, aber ich sehe sie jetzt mit anderen Augen als noch am Vormittag. Ich lege einen Zahn zu, denn meine Oma ist mir bereits einige Schritte voraus.
Text: Katja Wanke

Das Phänomen der weißen Sneaker –
eine kleine Anekdote von Willy Iffland
Oftmals werde ich gefragt, wie ich denn eigentlich zum Thema Sneaker und meiner Leidenschaft gekommen bin. Die Frage ist relativ leicht beantwortet. Durch den Air Force 1 – und wie kann es auch anders sein: ein weißer Sneaker.
Damals, als ich noch im jugendlichen Alter war und neun Monate sparen musste, um einmal im Jahr ein paar „coole Klamotten“ kaufen zu gehen, wollte ich unbedingt mein erstes eigenes Paar weiße Sneaker haben. Denn mit meinen 13 Jahren, die ich damals war, gab es für mich musikalisch gesehen nichts cooleres als Leute wie 50 Cent, die Diplomats, Jay-Z und Co. Und was haben alle neben der guten Musik gemeinsam? Richtig! Sie haben international eine Ära geprägt, nicht nur musikalisch, sondern auch Style-technisch. Und so kam es, dass ich als kleiner, pubertierender Junge auch unbedingt so einen Look haben wollte – ungeachtet dessen, dass das bei mir sowieso immer lächerlich aussah 😀 Also kaufte ich mir von meinem erspartem Geld hier und da mal ein 4XL Shirt, aber nie konnte ich mir einen Air Force leisten, denn zur damaligen Zeit waren circa 100 Euro für einen Schuh für mich undenkbar.
Weiße Sneaker sind glaube ich die oberste Spitze des Berges, was den Sneaker-Markt angeht. Ich kenne niemanden in meiner Bubble, der nicht mindestens ein NEUES und WEIßES paar Sneaker in seinem Schrank hat. Für einen Jungen aus der Kleinstadt war es damals nicht unbedingt üblich rumzulaufen, wie ein Wannabe-Rapper: Weite Baggy-Jeans, lange Shirts, ein paar Ketten aber das Wichtigste: die weißen Sneaker. Du warst einfach nicht cool, wenn du keine Air Force 1 schneeweiß getragen hast. Egal ob Jay-Z, 50 Cent, P Diddy oder Eminem – alle haben sie die Schuhe getragen. Die mussten richtig leuchten, dann hattest du was geschafft. Für mich immer ein Lebenstraum, den ich mir dann sehr schnell das erste Mal erfüllt habe.
Ich zog hinaus aus meinem kleinen 20.000 Menschen Städtchen in Thüringen mit Mutti nach Leipzig und nach stundenlangem betteln, argumentieren (wie es ein 13-Jähriger eben tut) und traurige Augen machen konnte ich dann wirklich meinen ersten eigenen Air Force kaufen. Ich denke es war damals bei Foot Locker oder einem anderen Sportgeschäft. Das war der Tag, an dem meine Sneaker-Leidenschaft so richtig entbrannt ist. Natürlich nicht auf dem Level, wie sie heute ist, aber ich war „awared“ für das Thema und letztendlich hat das meinen Weg bis heute weitestgehend geprägt und geebnet und mein Hobby zum Beruf werden lassen. Thank god for white sneaker 😀
Text: Willy Iffland

No hard Feelings
Vor einigen Monaten hatte ich einen Sportunfall und war gezwungen, mein Schuhwerk komplett zu überdenken. Ich war in ständiger und von mir verachteter Begleitung meiner ausgetragenen Joggingschuhe von Asics oder den klassischen Nike Air Monarch.
Als ich endlich gewillt war, meine Varianz an Sneakern auszuweiten, durchstöberte ich die diversen Online-Stores. Unweigerlich wurde mir der weiße Sneaker vorgeschlagen – ein Versprechen aus gesundem Schuhwerk und ästhetischem Design. Mir erschien das Bild von weißen Reebok Club C in Kombination mit Messenger Bag, Fanschal und Mom Jeans. Gefolgt von weißen Adidas Stan Smith mit Skinny Jeans auf Hochwasser, freiliegenden Knöcheln und Söckchen, die minimal aus den Schuhen blitzen. Und nicht zuletzt die veganen copycat Sneaker. Doch mit dem Fortschreiten meiner Recherchen fiel mein Auge auf den legendären Nike Air Force in all seinen Variationen und Kooperation, nicht zuletzt mit Dior. Die klassischen Converse durften in dieser Reihung natürlich auch nicht fehlen – high, low und plateau.
Von dieser Auswahl überrascht, interessierte mich die Meinung der einschlägigen Fachpresse. Während Vogue und GQ diese Schuhe nun in den Himmel lobten, zerschmetterte ELLE den weißen Sneaker in seine Einzelteile. Verwirrt von einem diametralen Meinungsbild auf der ersten Seite von Google Search kam ich zu dem Entschluss: Ich fühle es nicht oder eher, weiße Sneaker sind mir einfach egal.
Denn trotz dieser verheißungsvollen Aussicht auf eine Work-Life-Balance als Schuh getarnt, sträube ich mich dagegen. Zielsicher greife ich regelmäßig zum selbstzerstörerischen Gegenpart, da meine Bereitschaft für den unbequemen Schuh grenzenlos ist: die ersten Blasen nach 10 Minuten, Umknicken inklusive Bänderriss und als Krönung noch eine verkürzte Beinmuskulatur. Geprägt von einer Bilderflut an Schuhen, die ein (vermeintlich) erwachsener Mensch (vermeintlich) tragen soll, nehme ich die Aspekte meiner täglichen Begleitung wohlwissend in Kauf. Es gibt doch nichts über chunky Leather Boots, viel zu hohe High Heels oder wackelige Plateau Pantoletten. Auch nach sechs Monaten Schuh-Zwangspause – ohne neue erworbene Sneakers – fiebere ich sehnlichst auf den Moment, endlich wieder in meine zehn Zentimeter hohen Cow-Boots zu schlüpfen. Doch mein Schuhcomeback ist mit Vorsicht zu genießen – Gesundheit geht vor und meine Abneigung gegenüber weißen Sneakern gibt mir plötzlich prätentiöse Boomer Vibes.
Text: Paula Thomaka

Das Phänomen der weißen Sneaker
Als ich noch in der Schule war und als pubertierender Teenager versuchte meinen ganz eigenen Kleidungsstil zu entdecken, war ein Bild meiner Eltern während einer Grand Canyon Tour mein absoluter Favorit. Meine Eltern stehen lässig vor dem Mietwagen mit Blue Jeans und den typisch amerikanischen, weißen Oversized-T-Shirts aus Baumwolle. Mein Vater trägt Lederstiefel und meine Mutter Nike Sneaker in beige. Nachdem ich erfuhr, dass meine Mutter dieses Paar Schuhe immer noch besitzt, war für mich klar: Ich möchte sie auch tragen. Die Schuhe haben an meinen Füßen genau einen Schultag gehalten. Dadurch, dass sie so alt waren, ist die Sohle mit den Jahren ausgetrocknet und hat sich beim Tragen vom Rest des Schuhs gelöst. Meine erste Sneaker Erfahrung war also ein Reinfall – und ich enttäuscht von Sneakern.
Während meiner Schulzeit waren Nike Air Max One oder Converse großer Bestandteil der Schuhkultur meiner Mitschüler:innen. Weiße Converse sahen erst gut aus, wenn sie richtig durchgetragen waren. Sie komplett weiß und ohne Flecken zu tragen wurde eher belächelt. Die italienischen Mitschüler:innen trugen die Marken Kawasaki oder Superga, auch übergehend in weiß. Heute wiederholt sich im modischen Streetstyle nicht nur der Kleidungsstil, den meine Eltern damals trugen, sondern auch weiße Sneaker. Sie sind fester Bestandteil eines jeden WG-Hausflures oder Hauseingangs geworden. Als ich zum ersten Mal die Türschwelle meiner neuen WG in Wien zum Antritt meines Erasmus-Semesters betrat, war das erste was ich erblickte: ein ganzer Haufen weißer Sneaker. Ich selbst habe ein Paar weiße Sneaker mal von meinen Brüdern zu Weihnachten und ein Paar weiße Adidas Originals von einem Arbeitgeber geschenkt bekommen.
Wieso ich mir niemals welche gekauft habe? Weil ich tatsächlich als stark farbvisuell orientierter Mensch fast ausschließlich bunte Kleidung und Schuhe besitze. Weiße Sneaker gehen immer – sagen mir viele Menschen – aber identifizieren kann ich mich damit nicht wirklich.
Die Farbe weiß steht in vielen Kulturen für Unschuld, Reinheit und Unsterblichkeit. Wenn man jedoch hinter die Kulissen der Schuhkonzerne schaut, sind sie alles andere als sauber. Sneaker wie von der Marke Nike haben auch eine dunkle Seite zu ihrer weiß strahlenden Street Credibility. Nicht ohne Grund hat Nike 2021 – besser zu spät als nie – ihren “Supplier Code of Conduct” (Verhaltenskodex für Lieferanten) aktualisiert und spricht sich gegen Kinderarbeit und Zwangsarbeit aus. Gesundheitsschädliche Tätigkeiten sind grundsätzlich an ein Mindestalter geknüpft. Aber wer möchte eigentlich den ganzen Tag auf giftigen Stoffen rumlaufen? Unsere Füße tragen uns ein Leben lang, zumindest nehmen wir das selbstverständlich an. Also wieso nicht auch dort unten schauen, dass unsere Füße gesund bleiben und auch aus nachhaltigen Arbeitsverhältnissen kommen? Deswegen würde ich immer einen guten italienischen Lederschuh vorziehen, als glänzende Sneaker aus Plastik. Denn das Image weißer Sneaker mag man oberflächlich gesehen schön polieren können, aber ein Lederschuh von guter Qualität hält ein Leben lang. So gehe ich alle paar Jahre zum Schuster meines Vertrauens und unterstütze dabei ein langsam aussterbenden Handwerk, indem ich die altbekannten Schuhe zum Sohlen Wechseln vorbeibringe.
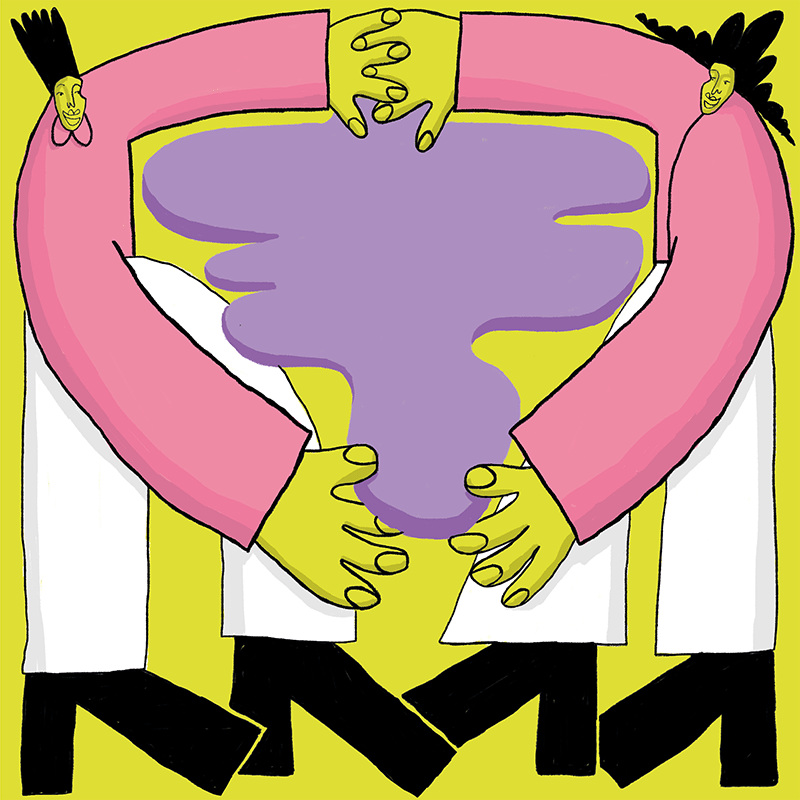
Wie werde ich politisch?
Texte:
Illustration: Rosa Viktoria Ahlers
Prolog: Francesca Romana Audretsch, Alexandra Zenleser
Redaktion: Francesca Romana Audretsch, Alexandra Zenleser
Das ganze Leben ist irgendwie politisch. Von der Musik, die wir hören, über die Kleidung, die wir tragen oder die Worte, die wir wählen, wenn wir miteinander sprechen. Es ist eine Herausforderung, jeden Tag seinen Mitmenschen ohne Vorurteile zu begegnen. Eine Allianz durch Vertrauen und Verständnis zu bilden braucht Zeit und muss erst geübt werden. Wir nehmen Haltungen ein, teilen unsere Meinung mit und fühlen uns Gruppen zugehörig, die gleiche Werte und Ansichten vertreten. Das eigene „politische Ich“ befindet sich im stetigen Wachstum und entwickelt sich immer weiter, mal bewusster und mal unbewusster. Aber ab welchem Punkt fängt der politische Aktivismus an?
Ein Bewusstsein zu schaffen, welche Rolle wir in der Gesellschaft durch die eigene Sozialisierung einnehmen und wo wir uns selber verorten möchten, ist ein erster Schritt. Hier fängt das „politische Ich“ an in uns zu arbeiten. Zum einen versuchen wir uns aus Haltungen, Äußerungen und Zugehörigkeiten bewusster zu formen und zu gestalten. Zum anderen können wir dann aus unserer eigenen gesellschaftlichen Bubble austreten und unsere Stimme für andere Menschen einsetzen. Diese Stimme zu finden ist nicht immer einfach, da es gerade im politischen Umfeld an Wissen bedarf. Voraussetzung sind Willenskraft, Hingabe und Fleiß. Die Form des Aktivismus bleibt dabei offen. Wir gründen Organisationen, engagieren uns in Ehrenämtern oder der eigenen Nachbarschaft, versammeln uns online oder zu tausenden auf der Straße. Jedes politische Engagement braucht das Demonstrieren, Unterstützen, Widersprechen und Aufmerksamkeit schaffen. Wie unsere Gäste politisch (geworden) sind und sich mit ihrem eigenen „politischen Ich“ auseinandersetzen, erzählen sie uns in dieser Ausgabe von Views.

Zum ersten Jahrestag des rassistischen Anschlags in Hanau las ich immer wieder „Erinnern heißt verändern“.
So könnte auch die Überschrift dieses Textes lauten.
Als ich als kleines Kind mit meiner Mama an einer Gedenkstätte an einem der Strände von Nordfrankreich stand und sie mir erklärte, wo wir sind und welche Bedeutung dieser Ort hat, konnte ich nicht aufhören zu weinen und zu sagen, dass ich keine Deutsche sein will. Ich begann mir verschiedene Sprachen auszudenken, die ich vor mich hin brabbelte, wenn wir im Urlaub waren. Mein Ziel war, dass niemand hören sollte, dass ich Deutsche bin.
Eines der ersten Bücher, das ich alleine las, war schließlich das Tagebuch der Anne Frank. Und je mehr ich mich mit der Geschichte meines Geburtslandes beschäftigte, vertiefte sich in mir das Gefühl von Scham. Scham als Folge von Schuld. Auch heute schäme ich mich in nicht wenigen Situationen. Doch ich habe mittlerweile verstanden, dass ich mich dadurch nicht lähmen lassen sollte, sondern ich dieses Gefühl für etwas einsetzen und nutzen kann. Und diese Erkenntnis allein ist wahrscheinlich einer der wichtigsten Schritte, um politisch zu werden. Zu merken, dass nicht alles so bleiben muss, wie es ist. Die eigenen Privilegien zu erkennen ist ein wichtiger Anfang, um damit zu arbeiten. Meine Bachelorarbeit umfasste beispielsweise eine fotografische Untersuchung von der sogenannten „kulturellen Identität“ und Integration in Deutschland. Vor ein paar Wochen gründete ich zudem, gemeinsam mit weiteren Kommiliton:innen einen Arbeitskreis für diskriminierungsfreie Lehre an meiner Hochschule, um endlich tiefgreifend gegen strukturellen Rassismus, ebenso wie gegen jegliche andere Form der Diskriminierung an einer öffentlichen Institution vorzugehen.
Und unter anderem begann ich mich vor ein paar Monaten intensiver mit meiner eigenen Familiengeschichte auseinanderzusetzen. Dabei stellte ich fest, dass einer meiner Uropas Parteimitglied der NSDAP war. Welche Position genau er in der Partei hatte konnte ich bisher leider noch nicht herausfinden. Ich weiß lediglich, dass er kein Soldat, sondern in der Buchhaltung tätig war. Er war nie in Kriegsgefangenschaft oder musste sonst irgendwelche Konsequenzen für seine Mitarbeit im Zweiten Weltkrieg erfahren.
In Deutschland wird uns immer wieder von verschiedenen Seiten zugesichert, sei es von Politiker:innen oder den Medien, dass die NS-Zeit ausreichend aufgearbeitet worden sei. Dass dies jedoch nicht der Wahrheit entspricht, zeigten zuletzt sehr deutlich die Künstler:innen Moshtari Hilal und Sinthujan Varatharajah. Sie etablierten hierzu die Begrifflichkeit „Menschen mit Nazihintergrund“ und allein die dadurch ausgelöste mediale Debatte ist eine erneute Bestätigung für die dringende Notwendigkeit einer kontinuierlichen Konfrontation mit unserer Geschichte. Viele Menschen mit Nazihintergrund sehen zwar keinen Anlass für eine vertiefende, tatsächliche Aufarbeitung des bestehenden Volkstraumas. Auch weil viele Personen nach wie vor enorm von den Positionen ihrer Vorfahren profitieren, sei es finanziell oder schlichtweg dadurch, dass Menschen mit Nazihintergrund in der Regel nicht von strukturellem Rassismus betroffen sind. Ganz davon freimachen kann sich jedoch niemand. Es ist gibt immer mehr Belege dafür, dass sich Erfahrungen, Traumata und auch Ideologien über die DNS auf die nächste Generation übertragen können. Dieses Phänomen nennt man transgenerationale Weitergabe. Dadurch können Symptome entwickelt werden, als hätten das Kind oder die nachfolgende Generation das Trauma selbst erlebt. Welche große Bedeutung und Folge dies für Deutschland hat, zeigen nicht nur die steigende Zahl der psychischen Erkrankungen oder das zunehmende Wachstum der AfD.
Für mich steht fest, dass eine Vermeidungshaltung nicht die Lösung ist und nicht weiter sein darf. Doch ich bin nur eine von vielen. Wir alle müssen uns erinnern, uns auch vermeintlich unbewussten Scham- und Schuldgefühlen stellen, uns mit der Vergangenheit und Geschichte unseres Landes und insbesondere unserer eigenen Familien auseinandersetzen, um politisch zu werden und etwas zu verändern.
Text: Lara Weins

Mein Schweigen schützt mich nicht mehr
Eine Selbstreflexion (und Hommage an Audre Lorde)
Was wäre, wenn Schweigen keine Option mehr ist? Das war es eigentlich nie, aber was wäre, wenn ich erkenne, dass Schweigen keine Option mehr für mich ist? Über uns wird gesprochen, das Mikro wird uns nicht gereicht. Zu emotional, zu laut, zu urteilend. Wir missverstehen, dabei sind wir missverstanden, so sehr, dass unsere Realität vor unseren Augen verschwimmt. Was bedeutet es zu sprechen? Ich meine, wahrhaftig zu sprechen. In Solidarität mit anderen und für mich zu sprechen. Es war Audre Lorde, die sagte: „Your silence will not protect you”. Ihre Worte klingen nach, während meine Worte Schlange stehen, Däumchen drehen, ungeduldig auf meiner Zunge tanzen, denn mein Schweigen schützt mich nicht mehr und deins erst recht nicht.
Ich erinnere mich an den letzten Sommer, als du sagtest, wir lernen zusammen sprechen. Sprechen lernen ist wie Laufen lernen. Holpernd und stolpernd Schatten überspringend, denn diese Schatten sind groß. Doch groß sind auch wir. Es war das Schweigen, das uns klein hielt. Ein paar blaue Flecken hier und dort, doch der Stöpsel ist gezogen. Die Worte fließen. Nicht zu heiß, lauwarm spricht es sich am besten und trotzdem zittere ich. Kalt ist mir, plötzlich wieder warm. Ich sehe mich um, suche nach dir, doch ich finde dich nicht.
Ich erinnere mich an den Winter, als du sagtest, du seist wirklich politisch. So politisch, dass du nicht sprichst. Kommt dein Schweigen mit besonderen Vorzügen, welche meins mir vorenthalten hat? Ich spreche von Allyship und Anti-ismus-Arbeit. Du sprichst von Allyship und schwarzen Quadraten. So gerne würde ich mit dir tauschen, dein Verständnis klingt so trügerisch einfach, oder einfach nur trügerisch. Quadrate, die dein Schweigen verdecken, die dich verdecken, denn ich suche nach dir, doch ich finde dich nicht.
Was wäre, wenn Schweigen keine Option mehr ist? Das war es eigentlich nie, aber was wäre, wenn wir alle erkennen, dass Schweigen keine Option mehr für uns ist? Schweigend haben wir die Bühne betreten, zitternd nach dem Mikro gegriffen und den Worten erlaubt Tango zu tanzen. Und wie sie tanzen. Emotional, laut, urteilend. Wir missverstehen nicht, wenn uns der Rücken gekehrt wird. Zensiert durch mich, zensiert durch dich, dein Augenrollen, das mir die Sprache nahm. Nicht mehr. Es war Audre Lorde, die jede Zensur von sich wies. Ich verlerne, ich lerne, ich höre zu, ich spreche, wir sprechen wahrhaftig. Schließlich gibt es Solidarität auch als Verb. Du weißt schon, ein Handlungswort, denn mein Schweigen schützt mich nicht mehr und deins erst recht nicht.
Text: Charlotte Decaille

Wie werde ich politisch?
„Wir müssen eben gemeinsam handeln“ – Rosa Luxemburg
Die Frage nach dem Politisch-werden beschäftigt den Menschen seit Jahrhunderten. Ob in der antiken Agora, welche als politischer Raum des Austauschs diente, oder in der revolutionären Pariser Kommune, wo es um demokratische Partizipation und die radikale Transformation der bürgerlichen Gesellschaft ging (1871). Auch heute ist diese brisante und vielschichtige Frage höchst relevant, denn in demokratischen Gesellschaften spielt politische Teilhabe eine zentrale Rolle, um sich den fortwährenden Herausforderungen und Widersprüchen der Gegenwart zu stellen.
Meiner Erfahrung nach braucht es neben dem konkreten Handeln und dem Sich-Auflehnen gegen Herrschaftsformen (Kapitalismus, Patriachat, Staat) zunächst eine kritische Attitüde, die sich auf das eigene Bewusstsein und das alltägliche Leben bezieht und gewisse Machtstrukturen erkennt und entzaubert. Außerhalb des Kritik-übens gibt es unzählige Aktivitäten, die das Politisch-werden untermalen: wählen gehen, plakatieren, demonstrieren, im Plenum diskutieren und in der öffentlichen Sphäre gesamtgesellschaftlich reflektieren und gestalten. Die Effizienz dessen zeigte erst kürzlich die erfolgreiche Abschaffung des Abtreibungsverbots in Argentinien, und die Demokratisierung der chilenischen Verfassung (durch eine verfassungsändernde Vollversammlung), welche der diktatorischen Ära unter Augusto Pinochet entstammt (1973-1990).
Ich erinnere mich an Etappen meines politischen Daseins, in denen ich zunächst nur auf das Mittel der Kritik zurückgegriffen habe und dadurch in einen Kreislauf des nimmer endenden Kritisierens schlitterte. Im Zusammenhang mit den Flüchtlingsströmen 2015 wurde mir bewusst, dass reines Kritisieren nicht ausreicht. Als Reaktion darauf machte ich dann den ersten konstruktiven und organisierten Schritt zum politischen Handeln. In einer lokalen Organisation, die ankommende Menschen versorgte, meldete ich mich als Freiwilliger. Mein Motto damals: internationalistisch denken und lokal handeln. Das bedeutete für mich mit Menschen in den Diskurs zu gehen, insbesondere darüber, dass gewisse Dinge innerhalb unserer westlichen Gesellschaften falsch laufen: Xenophobe und islamophobe Tendenzen (2015 wurden in Deutschland 222 Flüchtlingsunterkünfte angegriffen) sowie der europäische Schulterschluss mit Despoten (Türkei, Libyen, Niger) untermauert durch inhumane Flüchtlingsdeals sind nur die Spitze des Eisbergs. Langsam verstand ich, dass die Ungleichheiten und Katastrophen, die durch Kriege und Konflikte ausgelöst wurden in weiten Teilen auf historische und politische Konflikte zurückgehen (das Kolonialerbe und der barbarische Imperialismus). Und ich stellte fest, dass diese Tragödien nicht nur theoretisch in den Büchern, die ich las, existierten, sondern sich um mich herum reell abspielten.
Dabei sah ich mich mit meiner eigenen Familiengeschichte konfrontiert. Meine Eltern immigrierten in den 1970er Jahren aus Rumänien und Israel nach Deutschland und erweckten in mir den Wunsch nach Vielfalt und das Denken an eine Welt ohne Grenzen (denn die Diaspora ist Teil unserer Familienhistorie). Gleichzeitig beobachtete ich bereits während des Irakkriegs 2003 die grausame Tragweite politischer Machtspiele. Als Neunjähriger konnte ich dies jedoch noch nicht in das Gesamtbild einordnen. Zu diesem Zeitpunkt gingen Millionen Menschen auf die Straße, um gegen den unheilvollen Krieg um Ressourcen und geopolitische Einflussnahme zu protestieren.
In der Gegenwärtigkeit stimme ich mich mit meinem Neunjährigen-Ich überein: Es bedarf eines gerechten und friedlichen Umgangs mit Konflikten. Aus diesem Grund sehe ich mich selbst dazu berufen zu handeln und zu rekonstruieren. Ich bin seit Jahren im aktivistischen Kampf aktiv und diskutiere unaufhörlich mit meinen Mitstreiter:innen im und außerhalb des Plenums, was zu tun ist: Wir planen Demonstrationen gegen die Inhaftierung von Whistleblowern, schreiben Pamphlete über die sozio-ökologische Transformation, organisieren Veranstaltungen, die über die Missstände in dänischen Deportationscamps aufklären und solidarisieren uns mit anderen Kämpfen, wie erst kürzlich auf einer Anti-Rassismus Demonstration. Dabei versuche ich immer für progressive, demokratische und humanistische Ideen einzustehen, um diese nicht nur lokal, sondern auch transnational zu denken, wie zum Beispiel in der konkreten Form einer Green New Deal Graswurzelbewegung welche ich seit einiger Zeit unterstütze.
Der kamerunische Philosoph Achille Mbembe sagte etwas sehr Treffendes: Das Politische in unserer Zeit muss von dem Imperativ ausgehen, die Welt gemeinsam zu rekonstruieren und die Wunden zu heilen. Politisch zu werden ist demnach auch mit einer Verantwortung und Fürsorge verbunden, welche sich auf die Gesellschaft, die unterschiedlichsten Wesen, die Natur und das planetarische Miteinander bezieht. Denn wir müssen uns dessen bewusst werden, dass wir nur gemeinsam handeln können, um gesamtgesellschaftlich etwas zu verändern. Wir sollen pflegen, regenerieren und teilhaben, um Krisen und Katastrophen gemeinsam zu bewältigen und eine gerechtere und friedlichere Welt zu konstruieren.
Text: David Reich

Yoga ist politisch
Viele fangen an Yoga zu praktizieren, um fitter zu werden, um sich zu entspannen, um sich etwas Gutes zu tun. Wir gehen ins Studio, nehmen auf unserer Matte Platz, die Stunde beginnt, wir üben verschiedene Haltungen, die Yogastunde ist zu Ende, wir gehen wieder nach Hause. Heute waren wir im Yoga, ein Punkt auf unserer To-Do Liste ist abgehakt. Doch Yoga endet nicht in Śavāsana. Ganz im Gegenteil. Die Körperhaltungen unterstützen uns dabei rauszugehen und Yoga im Alltag zu leben.
Yoga bedeutet Einheit, beziehungsweise das Ziel von Yoga ist Einheit und Erleuchtung. Es gibt verschiedene Yogawege, um dieses Ziel zu erreichen. Einer davon ist Rāja Yoga, das königliche Yoga. Dieser Weg basiert auf dem achtgliedrigen Pfad des indischen Philosophen Patañjali. Der dritte Punkt auf diesem Pfad ist Āsana, die Körperhaltungen, die wir in typischen Yogastunden üben. Doch der erste Punkt auf diesem Pfad ist Yama. Yamas sind Verhaltensregeln im Umgang mit anderen Lebewesen und der Umwelt. Das bedeutet, als aller erstes geht es darum, wie wir uns anderen gegenüber aktiv verhalten. Es geht also nicht in erster Linie um uns selbst. Yoga findet also nicht nur auf der eigenen Matte statt, sondern auch im Außen, im Alltag, im wahren Leben.
Der erste Punkt der Yamas, also die erste Verhaltensregel, ist Ahiṃsa. Ahiṃsa bedeutet Gewaltlosigkeit. Du wirst also dazu aufgefordert anderen Lebewesen und der Umwelt keinen Schaden zuzufügen. Weder in Gedanken, Worten, noch in Taten. Das beinhaltet auch gewaltlos einzugreifen, wenn du Gewalt in Worten und Taten – ausgeübt durch andere – beobachtest.
In der Yogaszene setzen sich viele für den Tier- und/oder Umweltschutz ein. Wir ernähren uns zum Beispiel vegetarisch oder vegan, transportieren unsere Einkäufe mit Jutebeuteln statt Plastiktüten und fliegen vielleicht nicht mehr von Frankfurt nach Berlin, sondern nehmen lieber den Zug. Anders ist es bei Rassismus und wenn es darum geht dieses Thema zu diskutieren und aktiv anzugehen. Viele sagen „Ich sehe keine Hautfarbe“, „Ich mache da keinen Unterschied“, „Für mich sind alle Menschen gleich“, „Wir sind alle eins“, „Ich verspüre da keinen Handlungsbedarf meinerseits, denn ich bin ja nicht rassistisch“, „Ich konzentriere mich lieber auf Positives, denn so ziehe ich Gutes an“. Vielleicht fragst du dich jetzt, wo hier das Problem liegt?
Wir leben in einer Welt, in der wir aufgrund unserer Hautfarbe, Geschlechts, Sexualität, Religion, Körperform und anderen Merkmalen, unterschiedlich behandelt werden. Wenn eine weiße Person und eine Schwarze Person nebeneinander in Stuttgart auf der Straße laufen, erleben sie im selben Moment unterschiedliche Realitäten, denn sie sind unterschiedlichen Vorurteilen ausgesetzt. Auf dem Instagram Account @wasihrnichtseht seht ihr die Erlebnisse, die People of Color machen. Eine weiße Person macht diese Erfahrungen nicht und das nur aufgrund der Hautfarbe. Indem du also sagst, du siehst keine Hautfarbe, verschließt du die Augen vor der Lebensrealität vieler Schwarzer Menschen. Du ignorierst so das Problem und förderst es sogar, da du nichts dagegen unternimmst. Indem du dich ausschließlich auf Positives fokussierst, umgehst du das Negative, schaffst es jedoch nicht aus der Welt. Dieses Verhalten wird Spiritual Bypassing genannt. Das fatale daran ist, dass so das Negative Raum bekommt und sich ausbreiten kann, da es nicht aufgehalten wird. Es ist also essenziell anzuerkennen, dass wir leider noch nicht alle gleich sind, und dass wir aktiv etwas unternehmen müssen, um irgendwann alle gleich zu sein. Und dass wir eben auch aktiv etwas tun müssen, um das Ziel von Yoga zu erreichen.
Yoga ist also politisch. Denn ein neutrales Verhalten würde bedeuten sich auf die Seite des Unterdrückers zu stellen. Ahiṃsa (Gewaltlosigkeit) wird nicht durch Neutralität, sondern durch spirituellen Aktivismus gelebt.
Wie können wir nun Yoga nutzen, um antirassistisch zu sein? Indem wir kraftvolle Āsanas, Körperhaltungen, üben, bauen wir nicht nur Muskeln auf, sondern stärken auch unseren Geist und unsere mentale Kraft, die wir brauchen, um aktiv zu sein. Durch das achtsame Üben der Asanas und das fokussierte Sitzen in Meditation, schaffen wir nicht nur Bewusstsein auf der Matte, sondern nehmen dieses Bewusstsein mit in den Alltag. Die eigenen Gedanken lernen wir so aufmerksam wahrzunehmen. Darüber hinaus nehmen wir auch unsere Umwelt bewusster wahr, wir erkennen Ungerechtigkeit schneller, können uns daraufhin tatkräftig einsetzen und Zivilcourage zeigen.
Indem wir üben unsere Herzen weit zu öffnen, entwickeln wir Mitgefühl allen Lebewesen gegenüber. Ob sie uns optisch ähnlich sind oder nicht. Ein kraftvolles Mantra, das uns dabei helfen kann ist Lokāḥ Samastāḥ Sukhino Bhavantu. Die Bedeutung dieses Mantras ist: Mögen alle Lebewesen glücklich und frei sein. Und mögen meine Gedanken, Worte und Taten in irgendeiner Form zum Glück und zur Freiheit aller Lebewesen beitragen. Ich möchte dich dazu ermutigen, dieses Mantra nicht nur in Yogastunden wahrzunehmen, sondern von der Matte mit in deinen Alltag zu nehmen und es zu leben, sodass wir irgendwann Einheit, das Ziel von Yoga, erreichen.
Text: Amuna Schmid
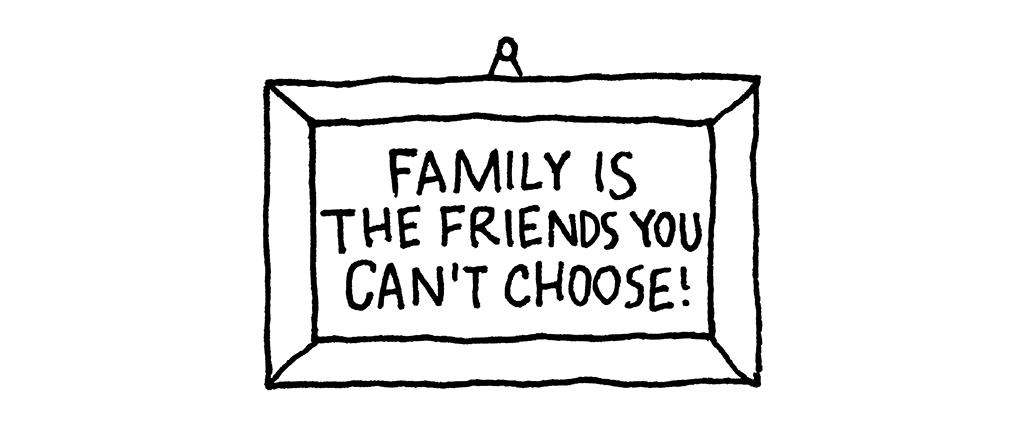
Familie
Texte:
Illustration: Ben El Halawany
Prolog: Alexandra Zenleser, Zweiter Autor
Redaktion: Alexandra Zenleser, Alexandra Zenleser
Eva Scholl, Luis Baltes und Lili Oberdörfer über Familie.
Ein Zuhause, Liebe, Zusammenhalt aber auch Verzicht, Verlust und Differenzen. All dies und mehr verbirgt sich hinter der Bezeichnung „Familie“. Ein Konstrukt, das uns in vielerlei Hinsichten prägt. Wir sind ein Teil von ihm und es umgekehrt eines von uns. Dabei ist Familie kein fester Begriff, sondern dynamisch und bunt in ihren verschiedenen Formen. Eltern, Geschwister, Verwandte, Lebensgemeinschaften, Kinder, Freundschaften oder Kollektive. Es ist das, was es für uns bedeutet.
In Familien treffen Meinungen, Generationen und Gefühle aufeinander. Kritik innerhalb dieses „Systems“, wie es Eva Scholl bezeichnet, zu äußern, bedarf Reflexion, Überwindung und Eigenständigkeit. Teil dieser Gemeinschaft und trotzdem frei im eigenen Denken und Handeln zu sein, ist ein Prozess, der sich bei jedem Familienmitglied ganz unterschiedlich äußert. Sehr still oder mit tosendem Lärm, durch Distanz oder Nähe, mit Humor oder Traurigkeit.
Jedes Familiengefüge ist einzigartig, so wie wir als Teil davon einzigartig sind.

Ich als ein Teil des Systems: meines Familiensystems.
Was bedeutet es, Kritik in einem System auszuüben, aus dem wir niemals austreten können?
Es ist die Rede vom Balanceakt unseres Selbst und unserer Identität in Beziehung zum System, welches uns – ob wir es wollen oder nicht – formt, berührt und sich in den Tiefen unseres Unbewussten manifestiert. Stelle ich mir die Frage nach Kritik innerhalb unseres Familiensystems, sehe ich die Hauptaufgabe von Kritik nicht darin zu bewerten oder Urteile zu fällen, sondern darin, das System der Bewertung selbst herauszuarbeiten, so wie der französische Denker Michel Foucault schon die Leistung der Kritik beschrieben hat. Warum jedoch sollte es wichtig sein, innerhalb seines Familiensystems Kritik zu üben? Es geht darum, eine Sichtbarkeit von Zuständen zu schaffen sowie über diese reflektieren zu können, um letztendlich andere Handlungsmöglichkeiten in Betracht zu ziehen. So stellt die Philosophin und Gendertheoretikerin Judith Butler in ihrem Essay über Foucaults Vortrag Was ist Kritik? folgende Frage: „Welches Verhältnis besteht zwischen Wissen und Macht, sodass sich unsere epistemologischen Gewissheiten als Unterstützung einer Strukturierungsweise der Welt herausstellen, die alternativen Möglichkeiten des Ordnens verwirft?“
Die Entwicklung der persönlichen Autonomie jedes einzelnen Familienmitgliedes empfinde ich daher als Bedingung für das Ausüben von Kritik innerhalb unseres Familiensystems. Autonomie bedeutet für mich die Fähigkeit zu besitzen, meine eigenen Handlungen und Entscheidungen treffen zu können. Es bedeutet für mich selbstbestimmt zu sein. Es ist wie eine Superkraft, die Fähigkeit zu besitzen zwischen dem zu differenzieren, was wir wollen und dem, was sich unsere Familie (wenn auch oft unbewusst suggeriert) wünscht. Damit einhergehend stellt sich folgende Frage: Gegen welche Regeln „verstoße“ ich innerhalb meines Familiensystems?
Nach dem Beenden der Schule wollte ich nur eines: weg von zu Hause. Ein neues Land, neue Menschen und eine neue Kultur kennenlernen. Ich ging für ein Freiwilliges Soziales Jahr nach Tel Aviv, zog danach zum Studieren nach Wien und lebe heute in Karlsruhe, mitunter um meine Familie aufgrund der räumlichen Nähe zu meiner Heimatstadt öfters sehen zu können. Damals ging es für mich darum, neue Erfahrungen zu sammeln und „die Welt zu sehen“ und mich ein Stück weit von meinem engsten Umfeld, meiner Familie, zu emanzipieren, mich ein Stück weit der lang ersehnten Autonomie anzunähern. Mit der Zeit merkte ich, dass ich mit diesem Versuch scheiterte mich meinem Wunsch, frei und unabhängig von den Gedanken, Konflikten und Meinungen meiner Familie zu sein, anzunähern. Ich spürte, dass es etwas anderes sein musste als die räumliche Distanz.
Was bedeutet es aber nun für mich autonom zu sein? Ich denke, es handelt sich um einen Prozess, der zunächst ambivalent erscheinen mag. Weil die einhergehende Bedingung zur Erlangung von Autonomie mit dem verbunden ist, wovor wir ursprünglich flüchten wollten: vor Bindung. Es geht darum, sich dem „System Familie“ anzunähern, sich selbst zu öffnen und mit den einzelnen Familienmitgliedern in Beziehung zu treten. Dazu gehört es, sich verletzbar zu machen und die eigenen Gefühle, Wünsche und Gedanken zu teilen. In Beziehung zu treten bedeutet ebenso, Konflikte zu führen, sich Zeit füreinander zu nehmen sowie Geduld zu haben. Es geht darum, Oma Gundula oder Onkel Peter zu erklären, warum mich Aussage XY wütend macht oder mit meinem persönlichen Verständnis der Welt nicht zusammenpasst.
Selbstverständlich ist es einfacher, sich physisch und emotional zu distanzieren, Konfrontation zu meiden statt in Beziehung oder Konflikte zu gehen – aber am Ende kommen wir nicht zum Ziel. Um autonom sein zu können, benötigen wir Nähe: körperliche und emotionale Nähe. Letztendlich bedeutet das, dass der Autonomie die Fähigkeit zur Bindung innewohnt. Diese Balance ist notwendig, um die Fähigkeit des Ausübens von Kritik zu erlangen, innerhalb des Systems, aus dem wir niemals austreten können.
Text: Eva Cathrin Scholl

Patch Work
Mein Vater hat mir mal durch die Blume gesagt, dass er seine Musikkarriere wegen mir aufgeben musste. Im ersten Augenblick klang das hart, ich hatte gerade ein Musikstudium abgeschlossen. Er meinte das aber nicht abwertend oder verletzend. Leicht wehmütig vielleicht, aber ich weiß er war stolz auf mich, dass ich den Weg einschlagen konnte, der ihm verwehrt blieb. Und vielleicht auch darauf, dass er in den Achtzigern die Entscheidung traf, statt einer professionellen Laufbahn als Gitarrist einen soliden Job angenommen zu haben um mich und zweieinhalb Jahre später meinen Bruder durchzufüttern. Er sagt sowas persönliches eigentlich immer nur, wenn er versucht, seine Gefühle auszudrücken. Deswegen blieb mir das Gespräch auch so gut in Erinnerung. Er ist nämlich ein Einzelgänger, der tief in seiner melancholischen Münchner Seele den Blues trägt. Das haben sowohl meine Mutter als auch später seine zweite Frau nicht lange ausgehalten. Die Bayern nennen das „Grant“ und zelebrieren das grummelige Unzufriedensein mal mit leicht lakonischem Humor, mal mit bitterem Bierernst. Mein Vater macht das gerne am Küchentisch mit der SZ in der Hand und dem Mittagessen auf dem Herd und schimpft leise über die Politik oder das Wetter. Dann kann man wunderbar mit ihm über Musik und den wilden Garten hinter dem Haus diskutieren. Er kocht leidenschaftlich gerne und muss das auch. Er hat aus zweiter Ehe vier junge Töchter – und er ist Witwer.
Als meine Stiefmutter nach kurzer Krankheit starb war das unglaublich schlimm für alle. Wir waren fassungslos und mein Vater stand vor der Situation, dass er im fortgeschrittenen Alter plötzlich alleine vier Teenager großziehen musste, die sich seit der Trennung ihrer Eltern bereits ein gutes Stück von ihm entfremdet hatten.
Er schafft das aber mit der Hilfe der ganzen Familie, ein paar Freunden und einer netten Nachbarsfamilie inzwischen sogar ziemlich gut. Väterlicherseits habe ich zwei Tanten, einen tollen Cousin, über den ich ein ganzes straßenkredibiles Rap-Album schreiben könnte, und eine stolze Cousine mit Mann und Kind.
Mein Bruder und ich wuchsen bei unserer Mutter auf. Ihr zweiter Mann war für uns ein wunderbarer Stiefvater, aber meine Mutter, eine begnadete Goldschmiedin, trägt eine Unabhängigkeit und eine Entschlossenheit in sich, mit der viele Männer aus ihrer Generation nicht gut umgehen können. Beide meiner Eltern sind also zweimal geschieden oder getrennt. Sie hat eine Woche nach ihrem Ruhestand freudestrahlend ein Kunststudium angefangen und malt seitdem fast jeden Tag ein bis drei Leinwände mit abstrakter Kunst voll. Sie wird immer besser und ihr Wohnraum immer kleiner. Alleinsein kann manchmal richtig beflügeln. Der Lockdown ist für sie eine willkommene Ausrede sich von der anstrengenden Gesellschaft, der sie jahrzehntelang in harter Arbeit den Vorzeigeschmuck schmiedete, endgültig abzukapseln. Sie hat nicht einmal mehr eine Katze.
Die Familie meiner Mutter ist für deutsche Verhältnisse riesig: Sie hat drei Geschwister, ursprünglich vier. Wir sind zehn Enkel und ein Urenkel. Die Großeltern, einer ihrer Brüder und der Mann meiner Tante sind leider bereits verstorben, aber ihre liebevolle Präsenz und ihre humanistischen Werte schwingen immer noch mit.
Einmal im Jahr gegen Sommer gibt es einen Familientag, bei dem sich alle Familienmitglieder irgendwo treffen und ein Wochenende lang viel trinken, viel essen und sich piesacken. Danach ziehen alle genervt und glücklich wieder ihrer Wege.
In der Familie meines Vaters mögen sie sich grundsätzlich eigentlich auch, aber so etwas anstrengendes wie einen jährlichen Familientag abzuhalten, noch dazu im Gegensatz zu Weihnachten völlig anlasslos, das käme weder ihm noch seinen beiden Schwestern jemals in den Sinn.
Die Scheidung meiner Eltern hat meinen Bruder damals etwas mehr mitgenommen als mich, aber er kommt mit Mitte Dreißig langsam darüber weg. Zutätowiert, Kunstfotografiestudium, Weltreisen, Berlin, tolle Freundin, kleine Wohnung, riesiges Herz.
Wir beide sind, wie unsere Eltern, die künstlerischen Ausreißer aus unseren hart arbeitenden hamburgisch-protestantisch, bayerisch-katholisch, rumänisch- und münchnerisch-agnostisch geprägten Familien.
Meine Mutter hatte meinen Vater beim Musizieren kennengelernt. Sie spielten in den frühen Achtzigern gemeinsam mit Freunden in Münchner Country-Bands – er als Gitarrist, sie als Sängerin. Sie war hübsch und muss so gut gewesen sein, dass sie sogar mal einen Plattenvertrag von einem dubiosen Schlagerproduzenten angeboten bekam. Die liefen damals über die kleinen Feste und durch die Clubs und signten schöne und talentierte Frauen, um sie in den unzähligen Dorfdiscos der Bundesrepublik zu verheizen. Wahrscheinlich habe ich ihr auch eine Musikkarriere verbaut. Vielleicht ist es aber auch besser so.
Text: Luis Baltes

Es ist endlich Wochenende. Die Ratten kriechen aus ihren Löchern, um sich auf einem alten Landhof zu treffen. Sie werden Tüten aufknabbern, sich im Holz verbeißen und anschließend Fressen finden.
Als die Großfamilie nach und nach eintrudelt, wird schnell ersichtlich, dass sich in dem alten Gasthof nicht ausreichend Betten für alle Anwesenden befinden würden. Bereits Monate vor dem Großfamilienwochende hatte Christa damit begonnen, in der letzten Ecke des Internets die preiswerteste Unterkunft für möglichst viele Personen aufzutreiben. Die Suche entwickelte sich dieses Jahr erneut zu einer lebenserfüllenden Beschäftigung, zum großen Leid ihrer Familie.
Christa transportierte einen Großkarton veganer Reismilch durch den Gang des Urlaubsdomizils. Wie bereits in den letzten Jahren, rührten weder ihre Schwester Rita noch ihr Bruder Emanuel einen Finger, um ihr zu assistieren. Dieses Jahr war es Christa erneut gelungen, den Preis des Urlaubes pro Person auf unter dreißig Euro zu minimieren. Von solchen Erfolgen lebte sie. Und sollte ihr verschnöselter Bruder noch einmal versuchen, die Finanzbilanz ihres Ausfluges durch unnötige Ausgaben zu manipulieren, würde das Folgen haben. Auf dem Familienwochenende wurde selbst gekocht, und zwar das, was über eine Doodle Liste abgestimmt wurde. Das war ihrem Bruder nicht recht. Kein Trüffel, kein Crémant. Bis heute war es Christa ein Rätsel, wie ihr Bruder aus den gleichen DNA- Bausteinen wie sie entstanden sein sollte. Für sie war er die Personifikation von Kapitalismus, eine Person, die, um das eigene Gewissen zu beruhigen, in ihrem Sportwagen ausschließlich Demeter-Lebensmittel transportierte. Dieses Auto, der weiße Jaguar F-Type, mit dem Emanuel vor drei Monaten bei ihren Eltern eingefallen war, der war ihr ein Dorn im Auge. Mit welcher Begeisterung ihr Vater damals um das Auto seines Sohnes kreiste, brachte sie zur Weißglut. Nicht nur ihr Bruder war also moralisch kompromittiert, sondern nun auch der Vater.
In diesem Moment meinte sie eine Stimme im Hof zu hören. „Christaaa, hallöchen!“ – das glockenhelle Lachen ihrer Schwester Rita hatte sie schon immer gestört, noch mehr als ihre stetigen astrologischen Ausführungen. Jetzt fehlte nur noch ihr Bruder Emanuel und dessen Familie. Schwer bepackt stapfte Rita durch den Gang in den Gemeinschaftsraum: „Ich brauche erstmal einen Kaffee, Mercury is in retrograde, you know“. Sie begab sich zu der im Eck stehenden Senseo Maschine. Für Rita eine große Enttäuschung, denn als Kaffeeliebhaberin war der Senseokaffee für sie nichts als braunes Wasser.
„Wunderschön dieses Haus, Christa, ganz toll ausgesucht!“ entzückte sich Rita, und säuberte ein ihrer Dreadlocks, die sich in ihre Kaffeetasse verirrt hatte. Ja hoffentlich, dachte Christa. Ihre Geschwister brachten stets die absurdesten Vorschläge an Reisezielen. Rita wollte in einem Wald campen, Emanuel hatte ein schweigendes Yoga-Retreat auf Bali vorgeschlagen. Das kam ihr nicht in die Tüte. „Ich habe Apfelstrudel von vorgestern mitgebracht“, säuselte Rita, „den könnten wir uns doch erstmal zur Stärkung genehmigen!“
Nachdem Emanuel verspätet eintrudelte, inklusive Assistentin und Dolmetscherin, klingelte sein Handy – ein Geschäftspartner aus China. Christa strafte ihn mit einem tödlichen Blick. Emanuel hingen die stetigen Großfamilientreffen zum Hals raus, kurz hatte er überlegt abrupt das Land zu verlassen, ein Jet stand stets bereit.
Christa hob das Glas: „Wie schön, dass wir alle zusammen sind!“
In diesem Moment krachte es ohrenbetäubend: Der weiße Jaguar F-Type durchbrach mit Vollgas die gläserne Verandatür des Landhauses. Das Auto krachte mit der Schnauze voraus in den Gemeinschaftsraum. Es klirrte und rumorte, bis endlich Stille eintrat. Der Apfelstrudel von vorgestern war um weitere Jahre gealtert. In den Überbleibseln des Sportwagens saß ihr Vater, und er blickte seinen drei Kindern erschrocken, aber genauso verschmitzt, in die Augen.
Text: Lili Oberdoerfer

Identität
Texte:
Illustration: Lili Oberdoerfer
Prolog: Alexandra Zenleser, Zweiter Autor
Redaktion: Alexandra Zenleser, Alexandra Zenleser
„Wer bin ich?” – Eine Frage, die manche von uns ein ganzes Leben lang beschäftigt. In manchen Momenten sehr bewusst, in anderen unterschwellig als ewiger Begleiter. Wie ein Schatten, der unsere Bewegungen nachahmt. Der unsere Form annimmt und dann doch wieder aus ihr herausbricht, sich entfremdet und dann beinahe etwas Unheimliches annehmen kann. Unabhängig davon, ob man sich die Frage nach der eigenen Identität stellt, begegnet sie einem doch früher oder später im Leben. Ob man möchte oder nicht.
Obwohl es kaum eine selbstbezogenere Frage gibt, tritt sie meistens erst in der Auseinandersetzung mit äußeren Faktoren auf. Eine Begegnung, eine Reise können dabei schon ausreichen, um scheinbare Gegebenheiten in Frage zu stellen. Sich auf den Weg nach neuen Antworten zu begeben und in sich selbst welche zu finden. Ist Identität dem Menschen unabänderlich in die Wiege gelegt, die Summe aus unseren Erfahrungen oder doch etwas Formbares? Kann sie sich im Laufe des Lebens ändern oder ändern wir nur unseren Blick auf sie?
Dass die Frage nach der eigenen Identität oftmals schmerzhaft sein kann, unbequem, verschwommen aber auch wundervoll, gefüllt von Erkenntnissen und persönlichem Fortschritt, zeigen uns unsere Gäste der November Ausgabe von Views: Wilhelmina, Lena und Saeed. Die eigene Identität kann eine Suche, eine Reise oder ein Weg in die Zukunft sein. Gefüllt von Orten, Sprachen und Menschen, findet man letztlich die Antwort nur in sich selbst.

Und ich träume auf Englisch.
die WhatsApp-Gruppe ist
der Krisenstab
und jede:r hat eigene Excel-Tabellen und Hochrechnungen
von Nevada und Georgia und Arizona
und ich bin auf Zoom mit Ariana Reines und den Poeten
als Freudenschreie von einem kleinen Video-Rahmen auf
den nächsten überspringen
und es ist strahlender Sonnenschein in Brooklyn und in DC
viel zu warm für einen November
und bald sehe ich Freund:innen auf Instagram zu
wie sie auf der Straße tanzen, wie sich der McCarren Park füllt
Wenn ich einen langen Tag habe, müde bin
schleicht sich mehr und mehr Deutsch in die krummen Sätze ein
und wenn es ein sehr, sehr langer Tag war, dann entfliehen mir bulgarische Wörter
und ich habe es nicht kommen sehen
Zehn Jahre lang konnte ich nicht schreiben
und dann begannen kleine Sätze sich ihren Weg zu bahnen
so weich noch, dass sie nur Ideen waren, unausgesprochen
auf Englisch
Und ich träume auf Englisch
betrinke mich auf Englisch
küsse auf Englisch
werde krank auf Englisch
erkläre KI auf Englisch
surfe auf Englisch
tröste auf Englisch
werde rot auf Englisch
im Stundentakt wird ein weiterer Ort, an dem wir uns sehnen zu sein erst einmal unerreichbar
im Spätsommer konnte man gerade noch so entkommen
Portugal und der Atlantik und ein bisschen weiter sogar
und Lissabon war leer
und ich sitze in Cíntia’s kleinem Studio im Nordwesten – lichtdurchflutet
See you next year, sagt sie nachdem sie die Tinte abgewischt hat
es ist windig am Tejo am letzten Abend
und es ist ein klein bisschen so wie Remarque es geschrieben hat
und Grenzen sind ein Ding,
das wir so vergessen haben
jetzt schreiben wir einander welches Land auf der neuen Liste steht
und meine liebsten Großeltern
oh meine Liebsten,
die ich nicht sehen kann
und zwei Zigaretten, die mit einer Liebe in Paris geblieben sind
und die Einladung sie in der roten Zone zusammen zu rauchen
und wie sehr wir uns verflochten haben
wie lange es gebraucht hat
und wie schnell wir uns an grenzenlose Freiheit gewöhnt haben
und wie schnell wir Wurzeln geschlagen haben
einen ganzen Wald
von der Atlantikküste bis zum Schwarzen Meer
Am Sonntag – sagt er – lass uns ein Haus in Sizilien kaufen
man kann gerade eines für einen Euro ersteigern
ja, und dann müssen wir miteinander reden, es war lange überfällig
und unsere Konversation ist auf Englisch
what are you afraid of?
Und dann wird es ein bisschen still
und dann sagt er nach ein paar Tagen
hier, Wilhelmina Welsch, Rilke’s Advent:
Es treibt der Wind im Winterwalde
Die Flockenheerde wie ein Hirt,
Und manche Tanne ahnt, wie balde
Sie fromm und lichterheilig wird;
Und lauscht hinaus. Den weissen Wegen
Streckt sie die Zweige hin – bereit,
Und wehrt dem Wind und wächst entgegen
Der einen Nacht der Herrlichkeit.
und es riecht nach ein bisschen Schnee
und nach Tannenbäumen
wie auf der Straße in Brooklyn vor Weihnachten
-ww
Text: Wilhelmina Welsch

Ein Brief an mich Selbst
Liebe Lenkica, oder sollte ich doch Lena sagen?
Ich schreibe dir, weil ich einfach mal wissen wollte… Wer bist du eigentlich? Dein Papa ist Deutscher. Du bist in Deutschland geboren, du bist hier zur Schule gegangen, du lebst und arbeitest hier. Es ist dein „Vaterland“. Manch eine:r würde sagen, dass du pünktlich und sorgfältig wie eine Deutsche bist. Also bist du Deutsche – das steht auch so in deinem Pass.
Aber warte mal kurz.
Deine Mutter ist doch Kroatin. Und schon von klein auf kennst und liebst du auch Kroatien. Bist du denn dann auch Kroatin? Das steht nicht in deinem Pass. Und eigentlich kannst du die Sprache ja auch nicht fließend sprechen. Du hast mir, also dir, mal gesagt, dass du dich aber auch als Kroatin fühlst. Du bist stolz, dass du ein Teil dieser Kultur, dieses schönen, kleinen Landes bist. Du sprichst immer von deinem „Mutterland“.
Bist du Deutsche? Bist du Kroatin? Bist du beides?
Du sagst du gehörst zum einen und zum anderen. Aber Du hast auch mal gesagt, dass du irgendwie weder ganz zum einen noch zum anderen gehörst. Das fühlt sich komisch an. Woran macht man eigentlich fest, wer man denn jetzt wirklich ist und welcher Nationalität man angehört? Hast du das schon rausgefunden?
Hat es damit zu tun welche Sprache du sprichst?
Kroatisch kannst du wie gesagt nicht fließend. Aber du fühlst dich wohl, wenn du es hörst. Du kannst gar nicht anders – es sind die Laute, die du von Kindesbeinen an mit Wärme, Liebe und Zugehörigkeit verbindest. Auch wenn du die Worte nicht immer genau verstehst, verstehst du eine tiefere Wahrheit, die sich nicht in Worte fassen lässt. Du kannst das auch nicht einfach ausstellen. Es ist ein Teil von dir, ob du willst oder nicht.
Hat es etwas mit Verhaltensweisen zu tun?
Du magst die Lautstärke am kroatischen Tisch, das Durcheinander von Händen, wenn alle gleichzeitig nach Pršut (Dalmatinischer Schinken) und Brot greifen. Manchmal nervt dich die Aufforderung mehr zu essen, wenn dein Bauch doch schon voll ist. Aber man will die Gastgeber:innen ja nicht beleidigen! In solchen Momenten schätzt du wiederum die deutsche Zurückhaltung: „Warum entschuldigst du dich? Ist doch ok, wenn du schon satt bist?“
Dabei erkennst du Züge beider Kulturen immer wieder in dir selbst: Wenn du Gäste einlädst, dann wünschst du dir, dass sie mit deutscher Pünktlichkeit erscheinen. Und beim Essen musst du dich zurückhalten sie nicht zu drängen, dass sie mehr als nur einen Teller nehmen. Das machst du ganz automatisch.
Hat es etwas damit zu tun, wo du dich zuhause fühlst? Klar bist du in Deutschland zuhause, du lebst hier schon immer. Aber…
Wenn du hier bist, dann vermisst du das dort. Wenn du dort bist, vermisst du das hier. Du bist gefangen in ständiger Sehnsucht, im Limbus. Und obwohl dieser dich plagt bist du stolz, denn du bist ein Wandler zwischen zwei Welten.
Ich würde es fast als Identitätsmultitasking bezeichnen: Du bist im ständigen Dialog mit zwei Kulturen, mit zwei Seiten deiner Selbst. Manchmal ist es anstrengend und du fühlst du dich völlig verloren. Manchmal ist es überwältigend schön und gibt dir eine unglaubliche innere Stärke.
Die meiste Zeit weißt du aber, dass es etwas ganz Besonderes ist. Ein Schatz, den du einfach so in dir tragen darfst – ganz selbstverständlich.
Bist du Deutsche? Bist du Kroatin? Ich bin beides.
Ist das nicht etwas ganz Wunderbares?
Text: Lena Barković

Dieses Jahr habe ich nach zehn Jahren Leben in Deutschland meinen deutschen Pass bekommen.
Es war schon aufregend, mit diesem bordeauxroten neuen Reisepass in der Hand aus der Ausländerbehörde, das für mich hässlichste Gebäude Stuttgarts, rauszulaufen. Dabei ist es nicht nur das Gebäude, es ist auch das Gefühl, das man in dem Gebäude als Ausländer hat. Als Außenseiter.
„Endlich (!!!1!!11!) nicht mehr hierherkommen müssen“ dachte ich, und bin aus der Tür gelaufen. Dabei habe ich auf den Reisepass in meiner Hand geschaut und als erstes die Europa-Sterne darauf entdeckt. Das hat mich umso mehr gefreut. Die Sterne, die ich so gerne auf meinem Hoodie oder meiner Cap trage, da ich an die Werte Europas glaube, waren jetzt auf meinem Ausweis. „Endlich gehöre ich auch dazu“, dachte ich.
Direkt danach habe ich mein Handy rausgeholt, ein Selfie mit dem Pass gemacht und das Foto meinen Eltern geschickt. Sie freuen sich am meisten für mich, dass ich jetzt eine zweite Staatsangehörigkeit habe. Sie waren es letztendlich, die mich hergeschickt und mir so ermöglicht haben meine Träume zu verfolgen. Zuhause wäre das schwierig gewesen. Die Regierung in Teheran akzeptiert Menschen wie mich nicht. Um dort zu überleben, müsste ich jetzt ein anderer Mensch sein. Dass ich hier akzeptiert werde freut meine Eltern – vor allem, dass sich ANGELA MERKEL jetzt um mich kümmert. Sie ist unter Iraner:innen sehr beliebt. Dort kennt man keine mächtige Person, die ihr gleicht. Vieles wofür Frau Merkel in Deutschland kritisiert wird, wird im Iran an ihr geschätzt und respektiert.
Nachdem ich das Selfie abgeschickt habe, hatte ich Lust auf Spazieren und Musik hören. Im ersten Lockdown bin ich 30 Jahre alt geworden, und habe mir für den Tag eine Playlist erstellt mit Tracks, die mein Leben und seine Phasen etwas zusammenfassen. Aber natürlich nur mit der Musik, die ich noch hören möchte. An „alles“ Alles muss man sich auch nicht zurückerinnern. Auf der Playlist kommt nicht viel Persisch vor, Deutsch schon eher. Aber insgesamt ist sie weder persisch noch deutsch. Ich würde es als „Weltmusik“ bezeichnen, und meine damit nicht das Genre bei Apple Music. An meinem Geburtstag war ich lange alleine. Diese Playlist zu erstellen hat mich glücklich gemacht. Kein Song ist dort ohne Grund festgehalten. Ich habe manchmal eher auf den Titel des Songs geachtet, das hat am meisten Spaß gemacht.
Nach ein paar Minuten spazieren und der Erkenntnis, dass ich jetzt den deutschen Pass besitze, musste ich daran denken, dass ich ja jetzt auch wählen darf. Und dass meine Stimme auch gezählt wird. Das letzte Mal habe ich 2009 im Iran gewählt. Die Stimmen von uns wurden eigentlich nicht gezählt, denn das Ergebnis war bereits entschieden.
Außerdem musste ich daran denken, dass ich jetzt deutlich einfacher reisen kann. Als Iraner ist Reisen nicht einfach. Der iranische Pass ist Dank der Regierung und deren Außenpolitik ziemlich wertlos geworden. Spontanes Reisen kann man vergessen und in viele Länder kommt man gar nicht erst rein. Das ist auch der Grund, warum ich noch nie in London, New York oder Tel Aviv war. Und trotz deutschem Pass stehen die Chancen auf eine USA- oder Israel-Reise für mich weiterhin schlecht, besonders seit Trump Präsident ist. Deswegen schätze ich Deutschland und Europa umso mehr.
Während ich mir überlegt habe, wohin ich mit meinem deutschen Pass als erstes hinreisen würde, kam ich auf eine dumme Frage: „Was antworte ich, wenn mich jemand im Ausland fragt, wo ich herkomme?“. Darauf gibt es eine kurze „sachliche“ Antwort, doch diese Frage beschäftigte mich trotzdem. Wie sehe ich mich selbst und womit identifiziere ich mich? Identifiziere ich mich überhaupt mit einer der beiden Nationalitäten so richtig? Ich wurde oft gefragt, woher ich komme und somit direkt in eine Schublade gesteckt. Vielleicht möchten Personen auch genau deshalb nicht gefragt werden, woher sie kommen. Einen großen Teil meines Lebens habe ich in Teheran gelebt, und lebe nun in Stuttgart, war aber auch eine lange Zeit in Europa unterwegs. All die Menschen in meinem Umfeld haben mich inspiriert. Alle, die ich kennenlernen durfte. Durch meine Reise habe ich aber auch vieles über Fehler von anderen Menschen gelernt.
Im Iran gibt es ein Sprichwort:
Adab raa as ke aamuchti? As Biadaban. .ادب را از که آموختی؟ از بی ادبان
Was so viel bedeutet wie: Von wem hast du deine Manieren gelernt? Von den Unanständigen.
In Deutschland darf ich sein wie ich bin. Deswegen schätze ich die Chance, die ich hier bekommen habe, besonders. Ich sehe es als eine zweite Chance. Darüber „Wer ich nicht bin oder nicht sein möchte“, könnte ich ein Buch schreiben, aber die Frage danach „wer ich bin“ ist für mich nicht so leicht zu beantworten. In meinem Schrank hängen zwar ein paar Iran Trikots, aber noch mehr Deutschland Trikots. Am meisten aber identifiziere ich mich mit meiner Cap mit den Europa Sternen darauf. Iran und Deutschland sind beide Teil meiner Identität, doch wenn ich in mich gehe, identifiziere ich mich am meisten mit Europa.
Vor allem in Europa erleben wir aktuell Zeiten, in denen viele Menschen es sich leisten können in eine Großstadt zu ziehen, ihren Instagram-Feed einmal auszusortieren, und von vorne anzufangen. Warum interessiert es uns dann immer noch so brennend, wo die Eltern oder Großeltern von jemandem „ursprünglich“ herkommen? Warum ist es in einer derartig vernetzten Welt überhaupt so wichtig wo ich herkomme?
Mittlerweile bin ich zuhause, also in Stuttgart-West, in meiner Wohnung angekommen und möchte mich nicht länger mit der Frage auseinandersetzen.
Ich erzähle viel lieber darüber, wo ich hinmöchte.
Text: Saeed

Nein sagen. Wie wichtig ist es Grenzen zu setzen?
Texte:
Illustration: Lili Oberdoerfer
Prolog: Alexandra Zenleser, Zweiter Autor
Redaktion: Alexandra Zenleser, Alexandra Zenleser
Im Job, in der Partnerschaft, in Freundschaften oder einfach im Alltag. Wir möchten möglichst positiv erscheinen und dem Gegenüber zu jeder Zeit gefallen. Hierfür eignet sich doch eigentlich nichts besser als das kleine Wörtchen „Ja”. Wir stimmen anderen Menschen zu, geben uns unkompliziert und stellen unsere eigenen Bedürfnisse, wie selbstverständlich, hinten an. Wir erwecken dadurch den Eindruck, alles unter Kontrolle zu haben. Als wäre es easy noch ein Projekt nebenher zu stemmen, die Diplomarbeit der Freundin zu korrigieren, obwohl man bereits mit den eigenen Aufgaben um Wochen in Verzug ist oder wieder einmal einen unpassenden Kommentar des Nachbars schweigend hinzunehmen. Vielleicht kennen wir oftmals einfach keinen besseren Ausweg als Zustimmung, um unangenehmen Situationen aus dem Weg zu gehen. Das bedeutet nicht, dass es per se schlecht ist Ja zu sagen. Im Gegenteil, es kann uns bereichern unbekannten Menschen und Umgebungen offen gegenüberzutreten. Es kann uns neue Herausforderungen bringen und wunderbare Erfahrungen bescheren.
Vielleicht kommt es, wie mit so vielem im Leben, auf die richtige Balance an. Was also, wenn wir anfangen bewusster mit Zustimmung umzugehen? Wir sagen Nein zu Dingen, die wir nicht gut finden, nicht schaffen oder schlichtweg nicht möchten und treten der Welt trotzdem lebensbejahend gegenüber. Das neue Credo könnte lauten: Wir sagen manchmal Nein, weil wir Ja zu uns selbst sagen.
Tiefe und bewegende Einblicke in ihre Gedanken, persönlichen Erfahrungen und Entwicklungen gewähren uns Francesca Romana Audretsch, Franziska Zoe Grimm, Grischa Beuerle, und Nelesuta.

Ein Nein ist ein Ja zu dir selbst – eine Ode an die Selbstliebe
Mensch sein ist ein rhythmischer Strudel aus Routine, Verantwortung, Leidenschaft und Resilienz, den es immer wieder aufs Neue zu durchschauen gilt – insbesondere während einer andauernden Pandemie im vermeintlich modernen 21. Jahrhundert.
„Covid-19 hat uns ein Ansteckungsmodell geliefert.“ manifestiert der Soziologe und Philosoph Bruno Latour in einem Interview mit The Guardian. „Dieses Virus lehrt uns etwas. Wenn man sich von einem Mund zum nächsten verbreitet, kann man sehr schnell die ganze Welt anstecken. Dieses Wissen kann uns zu neuer Handlungsfähigkeit verhelfen.“ Aber von was oder wem lassen wir uns heutzutage anstecken? Was treibt uns an und womit möchten wir im übertragenen Sinne andere anstecken und mitreißen? Ein aktives Nein sagen zu staatlich sanktionierter Gewalt, der Beraubung von Menschenrechten und Menschenwürde hat sich beispielsweise die #blacklivesmatter Bewegung trotz Einschränkungen des Versammlungsrechtes nicht nehmen lassen. Demonstrationen gegen Polizeigewalt sind ein unabdinglicher Ausdruck des Nein sagens.
Wenn der Terminkalender so getaktet ist, wie der Sprechstil eines Eminem Rap Songs und das Durchatmen schwer fällt, hat man sich meistens etwas übernommen.
Wir dürfen nicht aufhören die Krise als eine Aufforderung für Veränderung zu begreifen und neue Grundlagen für eine freiheitliche Gesellschaft gemeinschaftlich zu entwickeln und kollektiv zu praktizieren. Die temporären Kontaktbeschränkungen, die im März 2020 in Kraft traten, zwangen uns alle unser Ja-sagen zu hinterfragen und vor allem: Nein zu vermeintlichen Selbstverständlichkeiten zu sagen, die ein aktives Einbringen der eigenen Person voraussetzen. Während dieser ungewissen Zeit ist auch ein Raum für ungewohnte öffentliche Diskurse entstanden und hat uns einmal mehr gezeigt, dass wir als Gesellschaft eine Epidemie der anderen Art auslösen könnten: eine der Fürsorge, Solidarität und Teilhabe. Wieso vergessen wir zu spüren, wann wir an unsere Grenzen kommen? Wir kommen ganz unterschiedlich an unsere Grenzen: Im kollektiven Arbeiten, beim eigenen Anspruch, ein nachhaltiges Leben zu führen oder solidarisch der Familie, den Freund:innen und anderen Gemeinschaften zu begegnen. Jeder Mensch hat unterschiedliche Bedürfnisse und kommuniziert auf unterschiedlichste Weise mit sich und seinen Mitmenschen.
Fürsorge ist ein Ausdruck zwischenmenschlichen Einander sehen und verstehen wollen. Man schaut aufeinander, begegnet einander, sorgt sich umeinander, weil man eine gesunde Gemeinschaft und ein lebensbejahendes Klima schaffen will.
Der Appell hieße in diesem Falle: Lasst uns gemeinsam Nein sagen. Ein nach vorne schauen bedeutet in meinem Fall auch ein auf mich schauen. Wo sind meine Grenzen? Dies lernte ich mit einem klaren Nein sagen, mitten in einer sogenannten „Coronazeit”, die doch von Fürsorge geprägt sein könnte, von einem Mitdenken und gegenseitigem Respektieren. In diesem Fall war es ein Nein zu sexualisierter Gewalt, ein Nein zu ungefragten Körperkontakt, ein Nein zu einem Unverständnis bei der Überlegung eine Anzeige zu schalten. Dieses Erlebnis ließ eine Wunde aufplatzen, die nicht richtig vernarbt ist und nur sehr langsam heilt. Mir wurde an jenem Morgen schlagartig bewusst, dass ich solch ein Verhalten nicht mehr bewältigen kann und möchte, denn meine persönliche Grenze wurde ganz klar überschritten. Der hybride Folgezustand aus Abwehrreaktion und Schockzustand des gerade Erfahrenen ist nur schwer auseinander zu zerren.
Ich werde immer wieder Nein sagen und mir wünschen, dass sich alle Menschen damit anstecken lassen. Erinnerungsblitze an ähnliche Situationen begleiten mich, versuchen ihre Wege zueinander zu finden, ein angefangenes Puzzle zu beenden, emotionalen Wellen Stand zu halten. Ohne die Fürsorge meiner engsten Mitmenschen könnte ich nicht weiter mutig Nein sagen, obwohl das ebenso überlebenswichtig sein kann, wie die Nein-sagen-Regelung aufgrund der Pandemie. Denn ein Nein zu anderen ist ein Ja zu mir selbst – ein auf mich achten und Sorge tragen.

Nein sagen. Wie wichtig ist es Grenzen zu setzen?
Es ist ein warmer Oktobertag. Die Sonne scheint ockerfarben durch das Blätterdach, das sich raschelnd über mir im Wind wiegt. Der schwere Kopf meiner Carne-Corso-Hündin liegt in meinem Schoß. Ich überfliege die Seiten eines Hundeführers.
Eigentlich halte ich nicht viel von solchen Tipps, da ich mich selbst doch eher als erfahrene Hundemama bezeichne. Der letzte Satz regt mich jedoch zum Nachdenken an. Das Kommando „nein“ sollte eher mit einem anderen Wortlaut wie „aus“ oder „pfui“ ersetzt werden, da wir „nein“ zu häufig in unserem Alltag benutzen. Das könnte unseren vierbeinigen Freund verwirren.
Meine Gedanken fangen an zu kreisen.
„Nein“. Handelt es sich hier wirklich um ein häufig benutztes Wort in unserem alltäglichen Gebrauch? Du kennst es mindestens genau so gut wie ich. Wie oft hast du zum abendlichen Caesar Salad genickt, obwohl du dir doch so viel lieber die 4-Käse-Pizza bestellt hättest, nur um deine Freundin nicht zu enttäuschen? Wie oft hast du dich breit schlagen lassen, hast deinen Kumpel auf irgendeine ätzende Geburtstagsparty begleitet, obwohl du doch so viel lieber mit einem Bier in der Badewanne gelegen hättest? Ich könnte noch ewig so weitermachen und etliche Beispiele aufzählen, doch am Ende des Tages tun wir diese Dinge doch nur, um unser Gegenüber nicht zu enttäuschen.
Wir vergessen dabei leider häufig die anderen 50%, welche die zwischenmenschliche Beziehung vervollständigt. Führen wir nicht mit uns selbst eine genauso tiefe, bedeutungsvolle Beziehung? Eine Beziehung, die sogar unser Leben lang dauert und von der wir uns niemals lösen können?
„Fehlende Grenzen schaden der Beziehung“ steht in meinem Hundeführer. Völlig egal, ob Vierbeiner oder Zweibeiner. Ob Familie, Freund:innen oder Arbeitskolleg:innen. Unsere zwischenmenschliche Beziehungen besteht zu 50% aus dir und zu 50% aus mir. Es ist okay, auch mal „nein“ zu sagen und für seine Seite einzustehen. Es ist okay, auf sich selbst manchmal ein bisschen mehr Acht zu geben und seine Bedürfnisse zu kommunizieren. Ich bin mir sicher, dass deine Freundin lächelnd zu einer 4-Käse-Pizza nicken wird und den Salat getrost in die Tonne kloppt.
Ich schrecke aus meinem Gedankenkarussel auf, weil ich bemerke, wie mein pelziger Gefährte genüsslich auf meinen Birkenstock Sandalen herumkaut. „Pfui“ rufe ich, springe auf, lache und mache mich auf den Weg nach Hause. Auf die Badewanne freue ich mich schon seit heute Morgen.
Text: Franziska Zoe Grimm

Über das Nicht-Wissen, Nicht-Ja-sagen und extra Mayo
Wer weiß, dass er nichts weiß, weiß mehr als die meisten, denn die glauben sie wissen, wobei sie in Wirklichkeit nichts wissen. Was du hier siehst ist kein Zungenbrecher. In diesem kleinen Satz versteckt sich ein noch viel kleinerer Satz und er soll dir zeigen, dass die Logik es von dir verlangt, dich erst deiner Grenzen bewusst zu sein, bevor du dich selbst ernst nimmst. Denn ganz gleich, ob du Grenzen setzt: Sie sind da.
Alles beginnt mit dem Satz: „Ich weiß, dass ich nichts weiß.“ Paukenschlag. Spannungsflimmern. Moment! Was soll das eigentlich überhaupt heißen und wer schwingt sich zu solch widersprüchlich anmutender Aussage empor? Nun, lass mich einfach ausholen, dich abholen und einholen und dich umpolen. Vom Wissenden zum Unwissenden und wieder zurück.
Die Wissenschaft schafft Wissen. Quizfrage: Welche Wissenschaft hat das Wissen selbst zum Gegenstand? Richtig! Die Epistemologie. Epistemolowas? Die Epistemologie ist ein alter verstaubter Weinkeller, der vielleicht mal Glanz und Glorie, nun aber nur noch Husten und fragende Gesichter beherbergt. Sie ist die Lehre des Wissens selbst. Was also, oh antiker Dinosaurier der Wissenschaft, ist denn genau „Wissen“? Platon oder Sokrates, also auf jeden Fall einer von den Beiden (man ist sich da nicht allzu sicher), sagt: „Eigentlich ist Wissen nichts zu wissen.“
Der Standart-Ratgeber aus dem schon lange durch multinationale Großkonzerninteressen gebeutelten Buchhändler deines Vertrauens sowie die ersten 576 Forumsbeiträge zu „Lerne dich selbst zu lieben“ und „23 Tipps für ein gesundes Selbstbewusstsein“ werden dir Ratschläge erteilen – wie beispielsweise, dass du dich um dich selbst kümmern sollst. Lass dich doch einfach mal nicht stressen! Koch mal was Feines! Nimm ruhig ’ne extra Mayo! Unterm Strich alles keine falschen Ansichten. Aber du wirst kein glücklicher Mensch werden, wenn du nur ganz viel Mayo dazu bestellst. Ungeachtet dessen fetzt Mayo.
Der historische Sokrates war der Überzeugung: Was uns heutzutage (also damals) öfter fehlt, ist jemand, der uns auf den Boden zurückholt und uns hinterfragt. Jemand, der dir sagt, dass der Pullover scheiße ist, weil Kinderhände aus Bangladesch darin stecken könnten und deshalb eben kein woker, sustainable citizen 2.0 bist. Jemand, der dir sagt, dass du mal von deinem Film runterkommen sollst.
Das Problem dabei ist, niemand wird das für dich tun. Und selbst, wenn es jemand tut, dann wirst du dieser Person nicht einfach beipflichten. Niemand kann dir so gut widersprechen, wie du selbst. Niemand kann fühlen, was du fühlst. Niemand kann dich ansatzweise so therapieren, wie du selbst. Denn da zwischen dir und mir, da ist ein unsichtbarer Grenzzaun. Und jede Grenzüberschreitung ist destruktiv, denn sie lässt unsere Identität verschwimmen. Diese aber gilt es zu festigen, wenn wir mit uns im Reinen sein wollen.
Diese Grenze müssen wir uns vergegenwärtigen und das ist der erste Schritt. „Ich weiß, dass ich nichts weiß.“ Das heißt zuallererst, was es aussagt – nämlich dass sich das nicht-wissende Subjekt über sein Unwissen gewahr wird. Damit weiß das unwissende Subjekt also irgendwie schon irgendwas, auch wenn das „was“ ein „nichts“ ist und damit faktisch irgendwie doch nicht so richtig „was“ ist. Es bedeutet, dass wir uns klarmachen sollten, dass wir gar nicht so viel wissen, wie wir uns manchmal einreden.
Von da aus sieht die Welt ganz anders aus: Wir sind keine gelabelten Student:innen, Sportler:innen und was noch. Wir sind Menschen, die keine Ahnung haben, ob das alles so richtig ist, was wir da tun, aber wir arbeiten dran. Und von da aus können wir Raum schaffen für die Liebe, für die Neugier und für extra Mayo.
Text: Grischa Beuerle
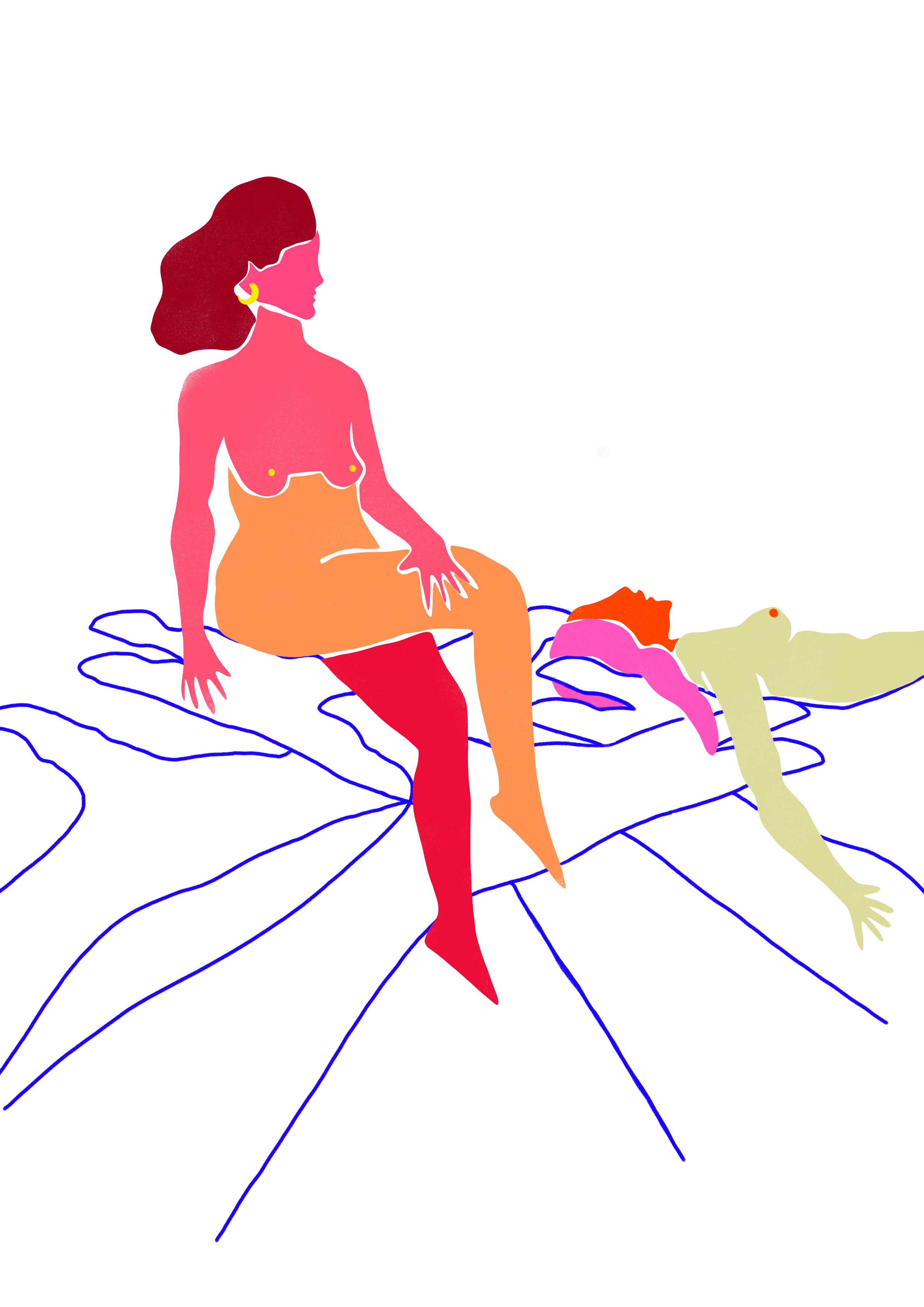
Nein, danke
Nein, danke.
Ich will meine Zeit nicht verschwenden.
Getragen werden von fremden Händen,
hoch hinaufsehen,
von hier werde ich nicht weggehen.
Nein, danke.
Ich will hierbleiben,
ich werde auch schweigen.
Den Moment nur genießen.
Nein, danke.
Lass mich ruhig alleine.
Nein, einsam bin ich nicht,
weil du immer in meinen Gedanken bist.
Text: Nelesuta

Reisen vs. Fußabdruck: Muss ich die ganze Welt gesehen haben?
Texte: Lena Barković, Lili Oberdörfer, Meltem Yurt, Lisa Raabe
Illustration: Malena Kronschnabl
Prolog & Redaktion: Alexandra Zenleser
31 Grad. Tageshöchsttemperatur. Du streckst deine Füße ins Wasser, lehnst dich zurück und betrachtest das von der Sonne durchdrungene Blau des Himmels.
Reisen. Die menschliche Sehnsucht den Alltag hinter sich zu lassen. Mal durchzuatmen oder in neue Abenteuer aufzubrechen. Na gut, dieses Jahr ist sowieso alles anders, aber wenn man über das Reisen in der heutigen Zeit nachdenkt, werden süße Fernwehgedanken schon einmal mit einer bitteren Note vermischt. Dem eigenen Fußabdruck. Die eigene Rolle wird zum Thema. Man könnte sagen, gut so.
Muss ich die ganze Welt gesehen haben? Lisa Raabe, freiberufliche Texterin und Redakteurin, Meltem Yurt, Werbetexterin und Autorin sowie Gründerin des Onlineblogs Themeltempot, Lili Oberdörfer, Journalistin und Lena Barković, Texterin, alle vier in Stuttgart lebend, haben sich genau diese Frage gestellt. Ehrlich, selbstkritisch, aktuell und sehr persönlich. Dass vielleicht auch wenige, intensive Momente ausreichen und wie jeder einzelne von uns seine ganz persönliche Antwort auf diese Frage finden muss. Vielleicht die beste Lektüre vor der nächsten Urlaubsplanung.

Ein Spaziergang in England – Momentaufnahme von Lena Barković
Hier bin ich also, sitze in meinem Zimmer und habe das Verlangen raus zu gehen und die lebendige Frühlingsluft einzuatmen. Meine Arbeit hier ist soweit erledigt, also nehme ich die Kamera und steige die Treppe herunter. Sie liegt schwer in meiner Hand. Eine Spiegelreflex. Nicht meine eigene, die meines Gastvaters. Aber er hat mir erlaubt, sie auszuleihen.
Als ich aus der Tür trete sauge ich mit meinen Augen den Anblick des Abends ein. Die schwindende Sonne hinterlässt die Welt in einem warmen, glänzenden Zustand. Ich starre die Blutbuche an, die neben unserem monströsen, hässlichen Haus wächst. Das weiche Abendlicht verleiht dem Schwarz der Blätter ein rötliches Glühen. Eine Farbe voll Wärme. Ich mochte den Baum schon immer. Er ist sehr hoch und ist dem Anschein nach sehr alt. Er steht dort schweigsam, aber ich kann das stille Leben in ihm spüren. Ich mag ihn einfach.
Die Blätter winken mir zu, fordern mich auf weiterzugehen. Die Sonne ist kurz vor dem Untergang. Es gibt keine Zeit zu verlieren.
Als ich die kleinen Steinstufen hinuntergehe verstehe ich wie sehr ich diesen Ort liebe. Meine Schritte sind weich. Es ist die Leichtfüßigkeit, die der Frühling mit sich bringt. Eine plötzliche Leichtigkeit des Herzens, die dem Leben so oft fehlt. Ich verwerfe den Gedanken, die Kamera wiegt schwer. Sie ist begierig Bilder dieses schönen Abends aufzunehmen. Ich auch.
Ich lasse meinen Blick über den See schweifen und denke nach. Ist es möglich sich in einen Ort zu verlieben? Ich vermute schon, denn es fühlt sich für mich so an, als ob mein Innerstes mit diesem wunderschönen Stück Erde verbunden ist. Natürlich ist es nicht nur die Natur, die mich fasziniert. Es ist das Gesamterlebnis, das meinen Geist erfüllt – und die Bereitschaft ein Teil davon zu sein. Das ist der Punkt, an dem ich begreife, dass ich hierher gehöre. Alles hier gehört zu mir und ich gehöre zu allem. Mein Herz klopft. Alles fügt sich zusammen. Der See liegt still vor mir und erwartet mich.
Ich komme, Schönheit …
Text: Lena Barković

Herr Er
Eine Kurzgeschichte von Lili Oberdörfer
Er ist auf der Mission die Umwelt zu retten. Im Urlaub säubert er nachts die Strände, fährt ausschließlich Fahrrad und studiert Biologie. Er ist sich bewusst über die Verschmutzung, die der Mensch täglich einer Erde zumutet, die er die seine nennt. So ein Mensch will er nicht sein. Klein wie Ameisen sind wir, denkt er sich. Unbedeutend. Wie gut, dass er das erkannt hat, denn jetzt sieht er das große Bild, hat Weitsicht, und es fühlt sich gut an. Er ist erleuchtet. Er gibt gerne Tipps, trotzdem versucht er die Kleingeister und ihre Freude im Mallorca-Urlaub nicht zu verurteilen. Den enormen Schaden, welcher bereits ein kurzer Flug der Erde zufügt, bereitet ihm trotzdem Bauchschmerzen. Er wird oft als Moralapostel dargestellt, dabei verstehen sie es einfach nicht, denn er tut das ja auch für sie.
Er verzichtet für sie. Er leidet für sie. Er steht schlecht da für sie. Die anderen. Sie werden getrieben von ihrem Ego, sie leben im Jetzt, leben vom Spaß und dem kurzen Glück. Sie sind oberflächlich. Aber er arbeitet auf das langfristige Glück hin, etwas das währen wird. Und es fühlt sich doch auch gut an, oder? Ja, das tut es, denkt er: Es fühlt sich hervorragend an, ein Vorreiter zu sein.
Aber in letzter Zeit spürt er eine Veränderung. In ihm regt sich des Öfteren etwas Hässliches. Er findet, es ist das Hässlichste was er je wahrgenommen hat. Anfangs hörte er nur ein tiefes entferntes Grunzen, mittlerweile kitzelt ihn der feuchte Atem des Ungestüms in seinem Nacken. Ausgelöst wurde es durch den Duft der Sonnencreme, der aus einem Reisebüro in seine Richtung zog, als er gestern die Straße überquerte. Da dachte er sich schon, was für eine Propaganda, wie egomanisch überhaupt ein Flugzeug nur zu betreten! Schon so lange verzichtet er auf Flugreisen, über die Schäden, die diese anrichten, könnte er einen Vortrag halten – was er auch tut. Aber dieser Duft, der hat ihn umgehauen. Seitdem kriecht er durch seinen Körper, und bringt ihn damit zur Weißglut. Überall riecht er Kokos und Sonne. Eines Morgens raunzt das Ungestüm ihm ein Wort in sein Ohr, das er so noch nie gehört hat. Tod, der Tod. Er kennt das Wort nicht, dessen Bedeutung umso weniger. Umso genervter ist er von dem Monster, das nicht mehr von seiner Seite weicht. Er entscheidet sich das Wort „klimaneutral“ zu googeln. Und was er dann sieht, kann er beinahe nicht glauben.
Er ist entgeistert, welch Dreistigkeit dies jetzt erst zu erfahren! Er erfährt von dem Tod, und davon, dass die eigene Zeit begrenzt ist. Dass Klimakatastrophen die Menschheit auslöschen, das klang für ihn immer nach einer unrealistischen Apokalypse. Und jetzt erfährt er das Menschen einfach so sterben?
Er fühlt sich betrogen, wieso hat ihm niemand davon erzählt? Es schüttelt ihn bis ins Mark. All die Arbeit, die er für die Zukunft getan hat, er wird sie nicht erleben können. Wenn er das nur gewusst hätte. Das ändert alles. Er hat das Schöne nach hinten geschoben. Er dachte, er habe unendlich viel Zeit die Früchte seiner Arbeit zu genießen. Kinder zu bekommen, die dann heile Welt zu bereisen, zu essen, zu schlemmen, zu lieben … So dachte er zumindest. Er fühlt sich betrogen von einer Welt, die ihn nicht eingeweiht hat. Er hat eine Entscheidung zu treffen.
Heute ist er Pilot, umrundet den Erdball täglich, um der Menschheit, die ihn so lange nicht eingeweiht hat, eins auszuwischen. Und so fliegt er die Menschen von Kontinent zu Kontinent, und beobachtet den langsamen Zerfall der Erde von oben.
Sie sieht so schön aus findet er.
Text: Lili Oberdörfer

Komm. Mach schnell. Pack deine sieben Sachen. Wir fliegen nach Wien für 12,99 Euro. Oder nehmen den Billigflieger nach Barcelona. Oder nein, lass nach Thailand reisen. Wir sind jung und die drei Zwischenstopps in Berlin, Brüssel und Abu Dhabi schlucken wir wie Sekt mit O-Saft, das wäre doch gelacht. Ja, das Reisen ist nicht mehr Luxusgut der oberen Klasse, sondern ein Lebensgefühl für die breite Masse. Flüge kosten mittlerweile gefühlt so viel wie gutes Olivenöl im Supermarkt und die Angebote an Möglichkeiten laden zum Expeditionsrausch ein: Aktive Vulkane in Chile oder biolumineszente Buchten in Puerto Rico? Ein Eishotel in Schweden oder doch lieber eine Soiree am pinken See in Australien? Bungalow oder Hausboot? Hoch in den Lüften oder tief unter Wasser? Such es dir aus, Amigo. Der Geldbeutel ist das Limit.
Im Reiserausch durch die Welt
Reisen ist herrlich. Jeder sollte reisen. Wenn du wirklich gebildet sein willst, solltest du wenigstens schon 12 Länder gesehen haben. Das Reisen ist wie eine Lebensausbildung geworden: Je mehr du siehst, desto mehr SIEHST du, je öfter du dich mit fremden Kulturen auseinandersetzt, desto offener wirst du der Welt gegenüber. Es ist wahr. Wenige Weltenbummler beschäftigen sich damit, ob ihre Hosen gebügelt sind oder nicht. Sie sind frei, unbelastet. So wie die Darsteller in den Schokoladenwerbungen.
Eine Vielreisende zu sein war immer das Optimum für mich. Mit Fleiß habe ich bisher 35 Länder besucht und bin stolz auf das Sammelsurium an Erlebnissen, das mich dabei fürs Leben geprägt hat. Wie viel CO2 dabei flöten ging? Keinen blassen Schimmer. Wenn es einen Flug für 35 Euro nach Rom gab, dann hieß es: Benvenuto a Roma.
Die Welt aber ruft schon seit längerer Zeit: „Basta, basta!“ Diesem Ruf entgegnete ich mit Semi-Interesse und ich schäme mich für meinen naiven Gedanken, dass ich als Einzelperson keinen Unterschied anrichten könne. Was für ein RTL2-Denken. Ich weiß, ich bin hier nicht die Einzige.
Eine merkwürdige Erkenntnis
Wir kämpfen mit einer Doppelmoral. Auf der einen Seite machen wir uns Sorgen um die Welt und wollen unseren Kindern eine bessere Zukunft garantieren. Auf der anderen Seite stürzen wir uns auf Skyscanner-Angebote wie ausgehungerte Hyänen, weil Reisen einfach dazugehört und eines der geilsten Dinge der Welt ist. Es ist wie eine Diät. Wir halten an der Aussicht auf eine Traumfigur fest und drücken uns im gleichen Moment Mayonnaise aus der Tube in den Mund. Dagegen anzukämpfen ist schwierig, wenn es anders so viel angenehmer ist.
Wenn die Welt stillsteht
Und dann plötzlich ändert sich alles. Ein mysteriöser Virus zieht uns einen Strich durch die Rechnung. Fast wie ein Würgereiz, der sich mitten beim Feiern breitmacht. Zum Kotzen, gerade wo‘s so lustig wird. Wir sind wütend und fühlen uns unserer Freiheit, unseres Spaßes beraubt. COVID ist so ein Arschloch. Durch ihn fallen alle Reiseplanungen für dieses Jahr flach. Wir Deutsche sind bezüglich unserer Ausgaben die reisegeilste Nation, gefolgt von den USA und Großbritannien. Und jetzt? Bali mit Schatzi, Ade. Malle mit den Boys, Goodbye. Jetzt müssen wir zuhause sitzen und uns mit dem beschäftigen, was unser Land uns zu bieten hat. Wie bescheuert ist das?
Aber Moment. Wittern wir hier eine Chance? Ist diese Atempause für uns – und für unsere Atmosphäre – vielleicht gar nicht so schlecht? Es ist wie in dem Moment beim Feiern, wenn wir neben der Kloschüssel sitzen und uns fragen: Will mir mein Körper gerade irgendetwas sagen?
Ja, der Körper will uns in dem Moment etwas sagen. Und genauso will der Kosmos uns etwas sagen. Wir sind also jetzt das Kind, das auf die Fresse geflogen ist. Es darf nicht mehr reisen gehen! All seine Flüge sind storniert worden! Zuerst zappelt es vor Wut, schreit und weint. Aber irgendwann beruhigt es sich. Es gibt nämlich noch andere Spielzeuge – und zwar in unmittelbarer Nähe.
Bali-Feeling in Bayern
Natürlich ist es viel cooler, Fotos an einer Strandbar auf Bali zu schießen und mit all seinen Freunden zu teilen. Aber am Ende des Tages geht es doch um das Gefühl dabei, oder nicht? Wir könnten diese interessanten Zeiten, in denen wir uns gerade befinden, dazu nutzen, das GEFÜHL zu leben. Nur ohne dabei die Gefühle unserer Welt zu verletzen. Die ist nämlich offensichtlich stinkig.
Und wenn wir genau hinhorchen, sind diese großartigen Reisegefühle oft nur eine Zugfahrt entfernt: Der Tibumana Wasserfall auf Bali gleicht täuschend den Buchenegger Wasserfällen in Bayern. Wer sich nach den Everglades sehnt, kann einfach mal eine Kanu-Tour durch die Gewässer des Spreewalds unternehmen. Sträubst du dich gegen Urlaub im Inland, dann surfe auf überwältigenden Wellen im französischen Hossegor wie auf Hawaii. Oder schwimm im Lago di Braies in Italien – dem Zwilling des Morraine Lakes in Kanada. Es kann so einfach sein. Und doch Berge bewegen.
Ein Beispiel, das den Unterschied verdeutlicht: Wenn du mit dem Zug von Berlin nach Prag reist, stößt du 8,3 Kilogramm CO2 aus. Mit dem Auto sind es 54,8 Kilo – und mit dem Flugzeug 107,9 Kilo. Für die Beispielzahlen sind mehrere Grundannahmen herangezogen worden, bei der Bahn etwa eine durchschnittliche Auslastung, bei Anreise auf der Straße ein Mittelklasse-Pkw mit Euro-5-Diesel.
Danke, dass ihr eure Ärsche zuhause lasst
Ja, für Reiseliebende – mich inklusive – sind solche Alternativen auf den ersten Blick wie Fake-Pflanzen: Sehen super aus aber riechen nach Plastik (ironischerweise). Vielleicht wird es Zeit, den Egoismus ein wenig herunterzuschrauben. So wie es durch COVID-19 erzwungen wird.
Wir malen uns im Gedanken aus, wie wir Fußabdrücke im Sand hinterlassen, während im Hintergrund das Meer rauscht. Wir sind so traurig. Was aber ist mit unseren Fußabdrücken auf dieser Erde? Wird sich uns je wieder so eine Gelegenheit zur Erkenntnis bieten?
Delfine in den klaren Kanälen Venedigs, zwitschernde Vögel am Times Square in New York City oder saubere Luft in chinesischen Smog-Städten wie Shanghai. Mutter Natur sagt uns auf diese Weise: Danke, dass ihr eure Ärsche zuhause lasst.
Text: Meltem Yurt

Die Welt, das Konsumobjekt
Es ist viel zu einfach, über die positiven Seiten des Reisens zu schreiben – die sind so offensichtlich. Denn leider ist es nun mal so: Alles, das extrem schöne Seiten hat, hat auch extrem hässliche.
„10 Orte, die du in deinem Leben gesehen haben solltest.” Es gibt ungefähr eine Million Artikel, die mir empfehlen, bestimmte Orte mit eigenen Augen gesehen zu haben. Aber: Muss ich reisen? Muss ich die ganze Welt mit eigenen Augen gesehen haben? Die Frage ist: Wer fragt denn hier? Aus wessen Sicht muss ich müssen? Aus meiner? Aus der Sicht der Gesellschaft? Aus Sicht der Reiseveranstalter?
Das letzte große Abenteuer.
Reisen ist das letzte große Abenteuer, das uns noch geblieben ist. Da wartet sie, die absolute Freiheit! Dafür müssen wir schon woanders hinfahren, hier können wir nicht frei sein. Also fahren wir weg. Und kommen wieder. Und fahren wieder weg. Und so weiter. Reisen ist kein Abenteuer mehr, es ist normal geworden. So normal, dass es für viele undenkbar ist, ihren Sommerurlaub zu Hause zu verbringen. (Es sei denn, es herrscht gerade eine Pandemie.) Es gibt ja auch gute Gründe, die fürs Reisen sprechen: Sie weiten das Blickfeld und zeigen, was möglich ist auf dieser Welt. Sie zeigen, dass unsere Art zu leben nicht die einzige ist. Dass Normalität subjektiv ist. Reisen erinnern uns daran, dass die Welt mehr als ein Kessel voll Spätzle ist. Aber gehört der jährliche Urlaub dazu? Oder reden wir uns das nur ein? Wenn ja, würde das bedeuten, dass alle, die keine Möglichkeit zum Verreisen haben, sei es aus monetären oder gesundheitlichen Gründen, zu einem Dasein zweiter Klasse verdammt sind. Das will ich nicht glauben.
Scheiß Touris.
Es ist magisch, den Tempel Tanah Lot bei Sonnenuntergang auf Bali zu sehen, diesen vom Meer umspülten Felsen, der nur, wenn Ebbe herrscht, zu Fuß erreichbar ist. Die Schönheit der Natur zu bestaunen und die rot-schwarz gefleckten, ebenfalls heiligen Schlangen zu berühren. Es ist toll, solange man den Blick ganz fest auf den Tempel richtet und nicht nach links und rechts blickt. Denn dann sieht man die unzähligen anderen Menschen, mit denen man dicht an dicht gedrängt steht. Die Mittouristen zerstören die Atmosphäre, aber nur die anderen, keinesfalls wir selbst. Wir tun ja gar nichts Böses, stehen nur ein bisschen rum. Die anderen sind es, die unser Reiseerlebnis eindämpfen. Als aufgeklärter und kritisch denkender Tourist hat man gefälligst andere Touristen zu meiden, denn Tourist möchte man nicht sein. Man ist Reisender.
Wer reist, ist Teil des Problems.
Wir reisen in die Ferne auf der Suche nach der Welt, wie sie ist. Bei so vielen, letztes Jahr waren es 1,5 Milliarden Touristen weltweit, kann die Welt, die wir heute serviert bekommen, gar nicht mehr real sein. Wie auch? Wir sehen nicht die Welt, wie sie ist, sondern wie sie für uns Touristen aufbereitet wurde. Wir sehen nicht mehr das „authentische” Bali, sondern ein für Menschenmassen durchorganisiertes Erlebniscenter. Das echte Bali findet woanders statt, hinter den Kulissen. Wenn es das überhaupt noch gibt – sicher bin ich mir da nicht.
Also dringen wir weiter vor. Wir möchten da essen, wo die Locals essen, da tanzen, wo die Locals tanzen. Nur: Es ist ein Trugschluss, davon auszugehen, dass man der oder die Einzige mit diesem Wunsch ist. Und so zwingen wir uns der Welt auf und drängen sie immer weiter zurück. Wir zerstören, was wir lieben, weil wir es unbedingt mit eigenen Augen gesehen haben wollen. Als könnten wir es dadurch besitzen.
Stell’ dir vor, du wohnst im Paradies und plötzlich wird dein Zuhause der nächste Urlaubsgeheimtipp. Plötzlich stehen fremde Menschen in deinem Vorgarten und verlangen nach Exotik, aber bitte nur ein bisschen. Auf Bali gibt’s Pizza, weil es Touristen gibt, die nicht in der Lage sind, sich für ein paar Wochen auf eine neue Welt einzulassen. Ich möchte nicht so sein, wie sie. Die Pizza habe ich aber auch gegessen. Jeder, der reist, ist irgendwo Teil des Problems. Aber das Schöne ist ja, dass dadurch jeder Teil der Lösung ist.
Kapitalismus trifft Kolonialismus.
Ich bin heilfroh, dass Stuttgart keine Touristenattraktion ist. Nur 2 Millionen Touristen kamenletztes Jahr nach Stuttgart. Davon vermutlich die Hälfte wegen des Festivals der Kotze, das zweimal pro Jahr in Bad Cannstatt wütet.
Die Mallorquiner, das hat man schon öfter gehört, sind keine Fans der Deutschen. Weil sie zu viele von uns kennen. Je mehr, desto besser, sollte man meinen. Wachstum ist schließlich die Religion unserer Zeit. Man darf nicht vergessen, dass die Tourismusbranche, wie jede andere Branche auch, auf Wachstum ausgerichtet ist. Reisen werden uns verkauft, sie sind Produkte. Sie gelten als Investition in sich selbst, man wird angeblich zu einem gebildeteren, interessanteren Menschen, wenn man Weltenbummler ist. Und wir glauben das gerne, weil es in unser Weltbild passt. It’s a lifestyle!
Will ich Teil einer ungeliebten Masse sein? Nein. Aber ich will auch nicht so ignorant sein, zu denken, dass ich einen super individuellen Urlaub machen und dafür in Bereiche eindringen darf, die vor dem Tourismus geschützt werden sollten. Wie viele Balinesen beten noch in Tanah Lot? Warum trennen wir das Kulturgut von der Kultur, die es erbaut hat? Mit welchem Recht eignen wir uns die Lebensräume anderer an? Wir tun das mit einer solchen Selbstverständlichkeit, als schlummere immer noch ein Kolonialherr in uns.
Glauben wir wirklich, dass sich der Rest der Welt darüber freut, wenn wir in ihrem Zuhause einfallen und es so verändern, dass es unseren Trends entspricht? Und glauben wir wirklich, dass das Geld, das wir dort lassen, unser Verhalten legitimiert? Können wir uns von unserer Verantwortung als Reisende freikaufen?
Gleichzeitig bin ich als Tourist an vielen Orten der Welt die wichtigste Einkommensquelle geworden. Na klar wollen Einheimische mit mir Geld verdienen. Ihnen bleibt ja nichts anderes übrig.
Reisen ist Müll.
Im sehr lesenswerten Interview mit dem Historiker Valentin Groebner erfährt man Interessantes über die Entwicklung des Reisens. Unter anderem auch, dass das Reisen, so wie wir es kennen, nicht älter ist als 70 Jahre. 70 Jahre! Es ist schon beeindruckend, wie viel wir in der kurzen Zeit zerstört haben. Man muss nur die Begriffe „Bali” und „Müll” googlen – die Bilder machen traurig.
Reisen zerstört die Umwelt. Flugreisen sind mit das Schlimmste, was man machen kann. Ein ökologisches Verbrechen, schreibt die Süddeutsche Zeitung. Unsere Umweltschädigung hört ja mit dem Verlassen des Flughafens nicht auf. Vor Ort produzieren wir tonnenweise Plastik. Hotels verbrauchen Wasser, das woanders fehlt. Der Preis, die Welt zu bereisen ist, dass wir sie zerstören.
Sollen wir jetzt alle nicht mehr reisen? Das ist weder wünschenswert noch möglich. Ich möchte ja selbst nicht darauf verzichten Meine Reisen haben mich wirklich zu einem offeneren Menschen gemacht und mir die allerschönsten Erinnerungen beschert. Dennoch müssen wir unsere Art zu reisen neu denken, denn wir sind alle mitverantwortlich dafür, damit es auch zukünftig möglich ist.
Vielleicht fragt sich jeder einfach mal: Warum reise ich? Was gibt es mir? Was erhoffe ich mir davon? Reise ich bewusst? Denke ich, dass ich einen Anspruch darauf habe? Wenn ja, warum? Kann ich mein Reiseverhalten vielleicht ändern? Fahre ich nicht mehr jedes Jahr weg, sondern alle zwei bis drei Jahre, aber dafür länger? Buche ich nur noch grüne Hotels? Verzichte ich auf Fleisch und reise dafür? Wer weiß, vielleicht stößt man dabei ja auf Antworten. Jeder darf seine eigenen finden.
Text: Lisa Raabe

Alleine oder zusammen? Welchen Stellenwert hat Gemeinschaft in unserer Gesellschaft?
Texte: Lilith Heidt, Rainer Brenner, Philip M. Stoeckenius
Illustration: Malena Kronschnabl
Prolog: Matthias Straub
Redaktion: Alexandra Zenleser
Status: It’s complicated. Wird es immer schwieriger, sich an einen oder mehrere Menschen zu binden? Jetzt wo wir analogen Lebewesen mehr denn je digitale Einblicke bekommen, wie wir als Menschen zu funktionieren haben, aussehen müssen und welchen Lebensentwurf es zu favorisieren gilt? Dank Instagram, Tinder, LinkedIn und Co. gelingt es uns immer besser, in Online-Inszenierungen sehr werbewirksam zu existieren – was es immer schwieriger macht, diese Projektionen mit den Lebensentwürfen anderer Menschen zu synchronisieren. Das gilt sowohl für Beziehungen im Sinne fester Partnerschaften als auch für Lebens- und Arbeitsgemeinschaften.
Aber ist es vielleicht nicht sogar viel effizienter innerhalb des selbst geschaffenen Kosmos mithilfe unzähligen Tools Projekte zu realisieren? Ist es anachronistisch in Gemeinschaften zu denken, zu leben und zu arbeiten? Möglichweise sind wir noch von der romantischen Vorstellung beseelt, dass Ergebnisse stets besser geraten, wenn unterschiedlicher Input und Inspiration, Ansichten, Fähigkeiten und ein echter Austausch zusammenkommen? Hilft, schadet, beschleunigt oder verhindert Diskurs den Prozess?
Rainer Brenner, freier Redakteur, Autor und Herausgeber aus Zürich, die in Stuttgart lebende Referentin Lilith Heidt und Philip Maria Stoeckenius, Autor, DJ und Lyriker, haben aus unterschiedlichen Perspektiven untersucht, welchen Stellenwert „Gemeinschaft“ heute hat. Dabei bleibt die Frage, ob wir die Bedeutung des Kollektivs überbewerten oder ob nicht vielleicht doch das gemeinsame Lösen alltäglicher und außergewöhnlicher Aufgaben gleichermaßen zielführend wie sinnstiftend ist.
Wir sind, weil ihr da seid
Man könnte meinen, dass in unserer Zeit die Selbstdarstellung fast zur Religion erhoben wird. Jeder möchte von seiner Umgebung so schön, intelligent und qualifiziert wie möglich wahrgenommen werden.
All the worlds a stage and all the men and women merely players…
(William Shakespeare)Zugegebenermaßen, es gibt natürlich noch einige Unterschiede zwischen der Theaterbühne und der Bühne des Lebens. Schließlich wissen die Schauspieler normalerweise, dass sie nur spielen.
Ist das Leben eine Bühne? Unsere Bühne?
Aber es gibt im Alltag kein „exklusives“ Publikum. Jeder Beobachter ist gleichzeitig auch ein Performer. Vereint auf der Bühne des Daseins beobachten und beurteilen wir die Handlungen unserer Mitmenschen und werden von ihnen wiederum interpretiert und bewertet. Das Spiel des Lebens ist ein kunstvoll arrangiertes Korbgeflecht aus vielen Rollen, Anforderungen und Möglichkeiten. Jeder muss sich daher täglich neu definieren und vor allem sich selbst neu darstellen. Nun denn, willkommen im Showroom des Seins, in dem man sich nur befindet, wenn man so tut, als wäre man es.
„To play or to be played“. Das ist die Frage.
Die Forderung: nichts anderes, als uns selbst zum Erzähler unserer eigenen Geschichte zu machen. Genrewechsel inklusive. Manchmal ähnelt unsere Lebensgeschichte eher einer Liebesgeschichte, manchmal erscheint sie wie ein Epos des Abenteuers. Ein Mensch: ein Spiegelbild, gebunden und verbunden durch die Fäden der sozialen Netzwerke.
Text: Lilith Heidt
The Artless Artist
Ich kenne einen Künstler. Den größten Künstler aller Zeiten. Denn ich habe nie etwas von ihm gesehen. Sein Werdegang begann nicht an einer Kunstschule. Auch nicht in einer coolen WG in irgendeiner angesagten Stadt oder an einem bitterarmen Ort in der Wüste. Ich habe eigentlich keine Ahnung, wo genau alles begann. Aber ich weiß, dass er gerne Sport trieb. Keinen Leistungssport, keine Medaillen, keine Artikel in der Zeitung. Einfach nur Bewegung, die seinen Körper mit Leben füllte.
Und er mochte Musik. Nicht die, die man hört, sondern diejenige, die ihm selbst gehörte. Nie in seinem Leben wäre es ihm in den Sinn gekommen, die Lieder anderer zu hören oder nachzuspielen. Warum auch? Er trug schließlich auch nicht ihre Kleider oder wohnte in ihren Häusern.
Wenn schon, dann suchte er in fremden Klängen nach Dingen, die zu seiner eigenen Musik passten. Wie in einem Bauwarengeschäft bewegte er sich durch die Musik anderer, um Werkzeuge, Befestigungen, Rahmen oder Kitt für seine eigenen Ideen zu finden. Ihm selbst gefiel seine Musik in manchen Wochen unglaublich gut. So gut, dass er sie fast selber nachgespielt hätte, um dazu zu tanzen – ein Begehren, das ihn ein Leben lang begleiten würde. Anfangs war er glücklicherweise zu faul dazu, später zu motiviert und noch später von einer tiefen Überzeugung geprägt.
Ich werde noch viel von ihm erzählen. Also geben wir ihm einen Namen. Niro vielleicht, denn so heißt bestimmt niemand, den Sie kennen. Trotzdem ähnelt der Name irgendwelchen bekannten Gesichtern und Charakteren. Und von genau so einer Person ist die Rede.
Niro diskutierte gerne. Am liebsten mit seinem Freund Dand. Von manchen Leuten wurde ihm vorgeworfen, er diskutiere eigentlich nur mit sich selbst. Denn wenn ihm eine Idee gefiel, so vertrat er sie nicht nur gegenüber seinen Gesprächspartnern, sondern auch gegenüber sich selbst. Er blickte ihnen zwar in die Augen, lachte, regte sich auf, trank und stammelte – aber eigentlich war er dabei meist ganz bei sich.
Dennoch: Er war kein einsamer Mensch. Und auch kein stiller Denker. Im Gegenteil, er liebte die Menschen um sich herum – seine Familie, Freunde, Menschen bei der Arbeit oder auf der Straße. Und er mochte Kunst. Nicht in Museen, nicht in Form von Bildern und Statuen. Sondern als Erlebnisse, Performances und unerwartete Begegnungen um ihn herum.
In seinem Smartphone, auf Zetteln und auf seinem Computer sammelte er Ideen für solche Kunst. Nachts, wenn seine Freundin schlief, lag er im Schein des Handybildschirms wach und blätterte mit dem Daumen durch die digitalen Seiten, träumte davon, diese Ideen irgendwann umzusetzen.
Dabei skizzierte Niro in seinem Kopf große Blätter mit Notizen. Wie die Profiler aus den Krimi-Filmen versuchte er sie miteinander in Verbindung zu bringen. Doch das funktioniert so nicht. Manche seiner Notizen waren nämlich voller Emotion und Farbe, andere hingegen handwerkliche Meisterstücke. Wieder andere bestanden aus den Menschen selbst oder waren gebaut aus Tiergelenken, unbekannten Wesen oder ganz und gar gasförmig. So scheiterten die größten, spannendsten, schönsten und bedeutendsten Werke in unendlicher Realität und zergingen in seinem Kopf, noch bevor er sie zu Ende gedacht hatte.
Und genau dieses Drama war der Beginn seiner eigentlichen Karriere. Was hinderte ihn wirklich daran, die Ideen zu Ende zu denken? Sie als multidimensionale, erlebbare, unendlich veränderliche und unbeschreibliche innere Wahrnehmung einem einzigen Zuschauer zu öffnen – nämlich sich selbst? Abgekoppelt von Realität, Plan und Umsetzbarkeit lag ihm eine Welt zu Füßen, welche sich an keinerlei Regeln zu halten hätte.
Anfangs erzählte er seinen Freunden davon. Mit der Zeit interessierte ihn das immer weniger. Im Gegenteil: Er versuchte beinahe, seine künstlerischen Spuren im Hier und Jetzt, die er auf Zetteln und in Dateien hinterlassen hatte, zu vernichten. Doch es tat weh. Und es war schwer, das Geheimnis ganz alleine zu tragen. Ganz ohne Bestätigung und Ruhm ein künstlerisches Einsiedlerdasein zu führen – ohne Vermächtnis, ohne Beweise. Darum sprach er darüber mit Dand. Nicht über die Werke an sich oder darüber, wie er sie gemacht hatte, denn dazu fehlte ihm das Vokabular und der nötige Intellekt. Sondern einfach von seiner Idee des neuen Künstlers, dessen Kunst sich nie auf der Schwerkraft der Erde beweisen muss, sich keinerlei Regeln unterwirft und keine Referenz als nur ihren Erschaffer kennt. Dand fand das zwar interessant. Aber er sang «Abenteuerland» von Pur. Und das nervte Niro.
Er schenkte sich sein Glas bis obenhin mit Wein voll und machte Witze über seine eigenen Ideen. Dand merkte das und es tat ihm leid. Also sprach er ihn immer wieder mal wohlwollend darauf an, versuchte sich für die Idee zu begeistern. Doch Niro blieb bei den Witzen und dem Wein und wirkte glücklich dabei.
Es existiert also eine Chance, dass Niro die grossartigste Kunst erschaffen hat, die die Menschheit je hervorgebracht hat – ohne dass jemals jemand davon erfahren würde. Man wird ihm zumindest nie etwas anderes beweisen können. Und je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr begeistere ich mich selbst für diese Vorstellung, mit dem bedeutendsten Künstler aller Zeiten befreundet zu sein. Ich mache ihn größer und größer, stelle mir vor, was Niro im Laufe der Zeit gesehen, erlebt und skizziert hat. Worüber er nachdachte, als er um seine Entwürfe kreiste. Daraus ergibt sich wiederum eine neue Parallelwelt zu Niros Dimension – und das Gesamtkonstrukt gewinnt an Größe.
Anders als Niro will ich nicht einfach Fan bleiben. Ich brauche Publikum. Menschen, die mit mir über meine Ideen und Arbeit sprechen. Oder alles abtun und Witze reißen. Und ich möchte ihn erlösen von seinem Einsiedlerdasein, ohne dass er dafür die Regeln zu brechen braucht, die seine Kunst bestimmen. Ich denke das ist alles, was er sich all die Zeit über von mir wünschte.
Dand
Text: Rainer Brenner
Gemeinschaft Ein Ausflug
Ich habe verlernt mit Menschen in einer Gemeinschaft zu leben? Diese Behauptung. Eine Frechheit. Man zwingt mich ja nicht während Zusammenkünften nicht zum funktionellen Denken. E=mc2 2 2 ^2 Welche Ziele2 hat meine Anwesenheit? Wer schafft als nächstes die Strukturen, an die wir uns halten? […] Macht es einen Unterscheid, ob Du mir nur das Bild zeigst, das Du von Dir zeigen willst. <img src="“https://musikwissenschaft.univie.ac.at/fileadmin/_processed_/" csm_dsc_0001_e273e8d765.jpg“>
Ich fühle mich wohler, wenn Du heute zuhause bleibst? Wir kennen uns ja jetzt – das reicht! Deine Geographie ist ja auch meine. Schön Dich zu sehen! Wie geht’s? […] Deine Gegenwart aber nicht. Dieser Voyeurismus kotzt mich an. In deinem Pass, den Dir Deine Nation, ausgestellt hat, steht „24,3k Follower*innen“ – wenigstens das. In nächster Zeit fliege ich nicht. Ich bin ein ungeselliger Geselle (Kant). Ich zitiere nicht mehr, ich habe Meinungen, die wichtiger sind als Deine Wissenschaft. Doch das glaubst Du mir nicht, stimmt’s? Ich glaube Dir ja auch nicht.
… Abonnieren.
Gefällt mir. Zustimmung
Text: Philip M. Stoeckenius