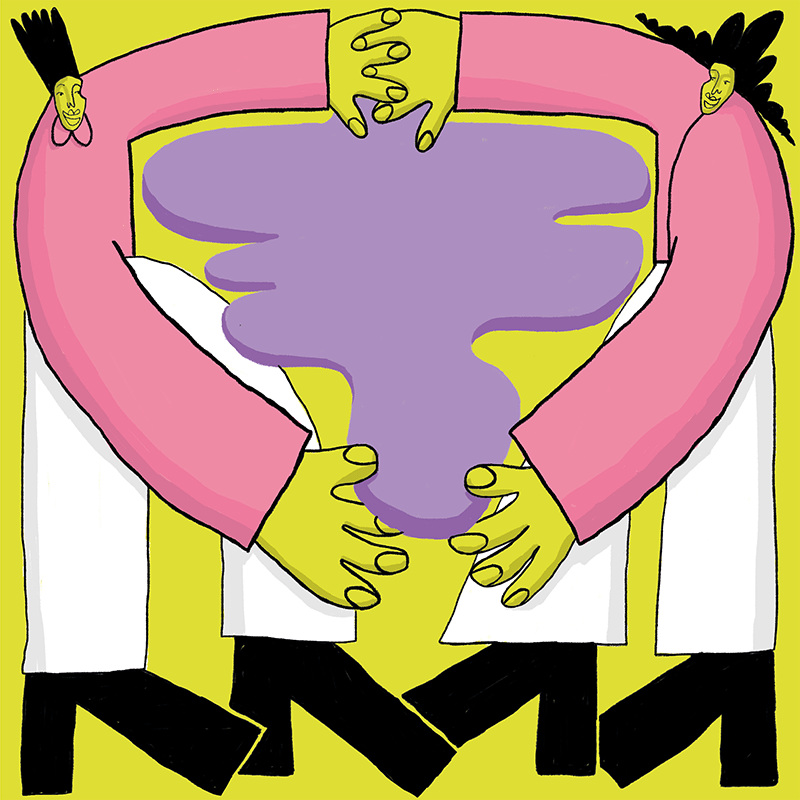
Wie werde ich politisch?
Texte:
Illustration: Rosa Viktoria Ahlers
Prolog: Francesca Romana Audretsch, Alexandra Zenleser
Redaktion: Francesca Romana Audretsch, Alexandra Zenleser
Das ganze Leben ist irgendwie politisch. Von der Musik, die wir hören, über die Kleidung, die wir tragen oder die Worte, die wir wählen, wenn wir miteinander sprechen. Es ist eine Herausforderung, jeden Tag seinen Mitmenschen ohne Vorurteile zu begegnen. Eine Allianz durch Vertrauen und Verständnis zu bilden braucht Zeit und muss erst geübt werden. Wir nehmen Haltungen ein, teilen unsere Meinung mit und fühlen uns Gruppen zugehörig, die gleiche Werte und Ansichten vertreten. Das eigene „politische Ich“ befindet sich im stetigen Wachstum und entwickelt sich immer weiter, mal bewusster und mal unbewusster. Aber ab welchem Punkt fängt der politische Aktivismus an?
Ein Bewusstsein zu schaffen, welche Rolle wir in der Gesellschaft durch die eigene Sozialisierung einnehmen und wo wir uns selber verorten möchten, ist ein erster Schritt. Hier fängt das „politische Ich“ an in uns zu arbeiten. Zum einen versuchen wir uns aus Haltungen, Äußerungen und Zugehörigkeiten bewusster zu formen und zu gestalten. Zum anderen können wir dann aus unserer eigenen gesellschaftlichen Bubble austreten und unsere Stimme für andere Menschen einsetzen. Diese Stimme zu finden ist nicht immer einfach, da es gerade im politischen Umfeld an Wissen bedarf. Voraussetzung sind Willenskraft, Hingabe und Fleiß. Die Form des Aktivismus bleibt dabei offen. Wir gründen Organisationen, engagieren uns in Ehrenämtern oder der eigenen Nachbarschaft, versammeln uns online oder zu tausenden auf der Straße. Jedes politische Engagement braucht das Demonstrieren, Unterstützen, Widersprechen und Aufmerksamkeit schaffen. Wie unsere Gäste politisch (geworden) sind und sich mit ihrem eigenen „politischen Ich“ auseinandersetzen, erzählen sie uns in dieser Ausgabe von Views.

Zum ersten Jahrestag des rassistischen Anschlags in Hanau las ich immer wieder „Erinnern heißt verändern“.
So könnte auch die Überschrift dieses Textes lauten.
Als ich als kleines Kind mit meiner Mama an einer Gedenkstätte an einem der Strände von Nordfrankreich stand und sie mir erklärte, wo wir sind und welche Bedeutung dieser Ort hat, konnte ich nicht aufhören zu weinen und zu sagen, dass ich keine Deutsche sein will. Ich begann mir verschiedene Sprachen auszudenken, die ich vor mich hin brabbelte, wenn wir im Urlaub waren. Mein Ziel war, dass niemand hören sollte, dass ich Deutsche bin.
Eines der ersten Bücher, das ich alleine las, war schließlich das Tagebuch der Anne Frank. Und je mehr ich mich mit der Geschichte meines Geburtslandes beschäftigte, vertiefte sich in mir das Gefühl von Scham. Scham als Folge von Schuld. Auch heute schäme ich mich in nicht wenigen Situationen. Doch ich habe mittlerweile verstanden, dass ich mich dadurch nicht lähmen lassen sollte, sondern ich dieses Gefühl für etwas einsetzen und nutzen kann. Und diese Erkenntnis allein ist wahrscheinlich einer der wichtigsten Schritte, um politisch zu werden. Zu merken, dass nicht alles so bleiben muss, wie es ist. Die eigenen Privilegien zu erkennen ist ein wichtiger Anfang, um damit zu arbeiten. Meine Bachelorarbeit umfasste beispielsweise eine fotografische Untersuchung von der sogenannten „kulturellen Identität“ und Integration in Deutschland. Vor ein paar Wochen gründete ich zudem, gemeinsam mit weiteren Kommiliton:innen einen Arbeitskreis für diskriminierungsfreie Lehre an meiner Hochschule, um endlich tiefgreifend gegen strukturellen Rassismus, ebenso wie gegen jegliche andere Form der Diskriminierung an einer öffentlichen Institution vorzugehen.
Und unter anderem begann ich mich vor ein paar Monaten intensiver mit meiner eigenen Familiengeschichte auseinanderzusetzen. Dabei stellte ich fest, dass einer meiner Uropas Parteimitglied der NSDAP war. Welche Position genau er in der Partei hatte konnte ich bisher leider noch nicht herausfinden. Ich weiß lediglich, dass er kein Soldat, sondern in der Buchhaltung tätig war. Er war nie in Kriegsgefangenschaft oder musste sonst irgendwelche Konsequenzen für seine Mitarbeit im Zweiten Weltkrieg erfahren.
In Deutschland wird uns immer wieder von verschiedenen Seiten zugesichert, sei es von Politiker:innen oder den Medien, dass die NS-Zeit ausreichend aufgearbeitet worden sei. Dass dies jedoch nicht der Wahrheit entspricht, zeigten zuletzt sehr deutlich die Künstler:innen Moshtari Hilal und Sinthujan Varatharajah. Sie etablierten hierzu die Begrifflichkeit „Menschen mit Nazihintergrund“ und allein die dadurch ausgelöste mediale Debatte ist eine erneute Bestätigung für die dringende Notwendigkeit einer kontinuierlichen Konfrontation mit unserer Geschichte. Viele Menschen mit Nazihintergrund sehen zwar keinen Anlass für eine vertiefende, tatsächliche Aufarbeitung des bestehenden Volkstraumas. Auch weil viele Personen nach wie vor enorm von den Positionen ihrer Vorfahren profitieren, sei es finanziell oder schlichtweg dadurch, dass Menschen mit Nazihintergrund in der Regel nicht von strukturellem Rassismus betroffen sind. Ganz davon freimachen kann sich jedoch niemand. Es ist gibt immer mehr Belege dafür, dass sich Erfahrungen, Traumata und auch Ideologien über die DNS auf die nächste Generation übertragen können. Dieses Phänomen nennt man transgenerationale Weitergabe. Dadurch können Symptome entwickelt werden, als hätten das Kind oder die nachfolgende Generation das Trauma selbst erlebt. Welche große Bedeutung und Folge dies für Deutschland hat, zeigen nicht nur die steigende Zahl der psychischen Erkrankungen oder das zunehmende Wachstum der AfD.
Für mich steht fest, dass eine Vermeidungshaltung nicht die Lösung ist und nicht weiter sein darf. Doch ich bin nur eine von vielen. Wir alle müssen uns erinnern, uns auch vermeintlich unbewussten Scham- und Schuldgefühlen stellen, uns mit der Vergangenheit und Geschichte unseres Landes und insbesondere unserer eigenen Familien auseinandersetzen, um politisch zu werden und etwas zu verändern.
Text: Lara Weins

Mein Schweigen schützt mich nicht mehr
Eine Selbstreflexion (und Hommage an Audre Lorde)
Was wäre, wenn Schweigen keine Option mehr ist? Das war es eigentlich nie, aber was wäre, wenn ich erkenne, dass Schweigen keine Option mehr für mich ist? Über uns wird gesprochen, das Mikro wird uns nicht gereicht. Zu emotional, zu laut, zu urteilend. Wir missverstehen, dabei sind wir missverstanden, so sehr, dass unsere Realität vor unseren Augen verschwimmt. Was bedeutet es zu sprechen? Ich meine, wahrhaftig zu sprechen. In Solidarität mit anderen und für mich zu sprechen. Es war Audre Lorde, die sagte: „Your silence will not protect you”. Ihre Worte klingen nach, während meine Worte Schlange stehen, Däumchen drehen, ungeduldig auf meiner Zunge tanzen, denn mein Schweigen schützt mich nicht mehr und deins erst recht nicht.
Ich erinnere mich an den letzten Sommer, als du sagtest, wir lernen zusammen sprechen. Sprechen lernen ist wie Laufen lernen. Holpernd und stolpernd Schatten überspringend, denn diese Schatten sind groß. Doch groß sind auch wir. Es war das Schweigen, das uns klein hielt. Ein paar blaue Flecken hier und dort, doch der Stöpsel ist gezogen. Die Worte fließen. Nicht zu heiß, lauwarm spricht es sich am besten und trotzdem zittere ich. Kalt ist mir, plötzlich wieder warm. Ich sehe mich um, suche nach dir, doch ich finde dich nicht.
Ich erinnere mich an den Winter, als du sagtest, du seist wirklich politisch. So politisch, dass du nicht sprichst. Kommt dein Schweigen mit besonderen Vorzügen, welche meins mir vorenthalten hat? Ich spreche von Allyship und Anti-ismus-Arbeit. Du sprichst von Allyship und schwarzen Quadraten. So gerne würde ich mit dir tauschen, dein Verständnis klingt so trügerisch einfach, oder einfach nur trügerisch. Quadrate, die dein Schweigen verdecken, die dich verdecken, denn ich suche nach dir, doch ich finde dich nicht.
Was wäre, wenn Schweigen keine Option mehr ist? Das war es eigentlich nie, aber was wäre, wenn wir alle erkennen, dass Schweigen keine Option mehr für uns ist? Schweigend haben wir die Bühne betreten, zitternd nach dem Mikro gegriffen und den Worten erlaubt Tango zu tanzen. Und wie sie tanzen. Emotional, laut, urteilend. Wir missverstehen nicht, wenn uns der Rücken gekehrt wird. Zensiert durch mich, zensiert durch dich, dein Augenrollen, das mir die Sprache nahm. Nicht mehr. Es war Audre Lorde, die jede Zensur von sich wies. Ich verlerne, ich lerne, ich höre zu, ich spreche, wir sprechen wahrhaftig. Schließlich gibt es Solidarität auch als Verb. Du weißt schon, ein Handlungswort, denn mein Schweigen schützt mich nicht mehr und deins erst recht nicht.
Text: Charlotte Decaille

Wie werde ich politisch?
„Wir müssen eben gemeinsam handeln“ – Rosa Luxemburg
Die Frage nach dem Politisch-werden beschäftigt den Menschen seit Jahrhunderten. Ob in der antiken Agora, welche als politischer Raum des Austauschs diente, oder in der revolutionären Pariser Kommune, wo es um demokratische Partizipation und die radikale Transformation der bürgerlichen Gesellschaft ging (1871). Auch heute ist diese brisante und vielschichtige Frage höchst relevant, denn in demokratischen Gesellschaften spielt politische Teilhabe eine zentrale Rolle, um sich den fortwährenden Herausforderungen und Widersprüchen der Gegenwart zu stellen.
Meiner Erfahrung nach braucht es neben dem konkreten Handeln und dem Sich-Auflehnen gegen Herrschaftsformen (Kapitalismus, Patriachat, Staat) zunächst eine kritische Attitüde, die sich auf das eigene Bewusstsein und das alltägliche Leben bezieht und gewisse Machtstrukturen erkennt und entzaubert. Außerhalb des Kritik-übens gibt es unzählige Aktivitäten, die das Politisch-werden untermalen: wählen gehen, plakatieren, demonstrieren, im Plenum diskutieren und in der öffentlichen Sphäre gesamtgesellschaftlich reflektieren und gestalten. Die Effizienz dessen zeigte erst kürzlich die erfolgreiche Abschaffung des Abtreibungsverbots in Argentinien, und die Demokratisierung der chilenischen Verfassung (durch eine verfassungsändernde Vollversammlung), welche der diktatorischen Ära unter Augusto Pinochet entstammt (1973-1990).
Ich erinnere mich an Etappen meines politischen Daseins, in denen ich zunächst nur auf das Mittel der Kritik zurückgegriffen habe und dadurch in einen Kreislauf des nimmer endenden Kritisierens schlitterte. Im Zusammenhang mit den Flüchtlingsströmen 2015 wurde mir bewusst, dass reines Kritisieren nicht ausreicht. Als Reaktion darauf machte ich dann den ersten konstruktiven und organisierten Schritt zum politischen Handeln. In einer lokalen Organisation, die ankommende Menschen versorgte, meldete ich mich als Freiwilliger. Mein Motto damals: internationalistisch denken und lokal handeln. Das bedeutete für mich mit Menschen in den Diskurs zu gehen, insbesondere darüber, dass gewisse Dinge innerhalb unserer westlichen Gesellschaften falsch laufen: Xenophobe und islamophobe Tendenzen (2015 wurden in Deutschland 222 Flüchtlingsunterkünfte angegriffen) sowie der europäische Schulterschluss mit Despoten (Türkei, Libyen, Niger) untermauert durch inhumane Flüchtlingsdeals sind nur die Spitze des Eisbergs. Langsam verstand ich, dass die Ungleichheiten und Katastrophen, die durch Kriege und Konflikte ausgelöst wurden in weiten Teilen auf historische und politische Konflikte zurückgehen (das Kolonialerbe und der barbarische Imperialismus). Und ich stellte fest, dass diese Tragödien nicht nur theoretisch in den Büchern, die ich las, existierten, sondern sich um mich herum reell abspielten.
Dabei sah ich mich mit meiner eigenen Familiengeschichte konfrontiert. Meine Eltern immigrierten in den 1970er Jahren aus Rumänien und Israel nach Deutschland und erweckten in mir den Wunsch nach Vielfalt und das Denken an eine Welt ohne Grenzen (denn die Diaspora ist Teil unserer Familienhistorie). Gleichzeitig beobachtete ich bereits während des Irakkriegs 2003 die grausame Tragweite politischer Machtspiele. Als Neunjähriger konnte ich dies jedoch noch nicht in das Gesamtbild einordnen. Zu diesem Zeitpunkt gingen Millionen Menschen auf die Straße, um gegen den unheilvollen Krieg um Ressourcen und geopolitische Einflussnahme zu protestieren.
In der Gegenwärtigkeit stimme ich mich mit meinem Neunjährigen-Ich überein: Es bedarf eines gerechten und friedlichen Umgangs mit Konflikten. Aus diesem Grund sehe ich mich selbst dazu berufen zu handeln und zu rekonstruieren. Ich bin seit Jahren im aktivistischen Kampf aktiv und diskutiere unaufhörlich mit meinen Mitstreiter:innen im und außerhalb des Plenums, was zu tun ist: Wir planen Demonstrationen gegen die Inhaftierung von Whistleblowern, schreiben Pamphlete über die sozio-ökologische Transformation, organisieren Veranstaltungen, die über die Missstände in dänischen Deportationscamps aufklären und solidarisieren uns mit anderen Kämpfen, wie erst kürzlich auf einer Anti-Rassismus Demonstration. Dabei versuche ich immer für progressive, demokratische und humanistische Ideen einzustehen, um diese nicht nur lokal, sondern auch transnational zu denken, wie zum Beispiel in der konkreten Form einer Green New Deal Graswurzelbewegung welche ich seit einiger Zeit unterstütze.
Der kamerunische Philosoph Achille Mbembe sagte etwas sehr Treffendes: Das Politische in unserer Zeit muss von dem Imperativ ausgehen, die Welt gemeinsam zu rekonstruieren und die Wunden zu heilen. Politisch zu werden ist demnach auch mit einer Verantwortung und Fürsorge verbunden, welche sich auf die Gesellschaft, die unterschiedlichsten Wesen, die Natur und das planetarische Miteinander bezieht. Denn wir müssen uns dessen bewusst werden, dass wir nur gemeinsam handeln können, um gesamtgesellschaftlich etwas zu verändern. Wir sollen pflegen, regenerieren und teilhaben, um Krisen und Katastrophen gemeinsam zu bewältigen und eine gerechtere und friedlichere Welt zu konstruieren.
Text: David Reich

Yoga ist politisch
Viele fangen an Yoga zu praktizieren, um fitter zu werden, um sich zu entspannen, um sich etwas Gutes zu tun. Wir gehen ins Studio, nehmen auf unserer Matte Platz, die Stunde beginnt, wir üben verschiedene Haltungen, die Yogastunde ist zu Ende, wir gehen wieder nach Hause. Heute waren wir im Yoga, ein Punkt auf unserer To-Do Liste ist abgehakt. Doch Yoga endet nicht in Śavāsana. Ganz im Gegenteil. Die Körperhaltungen unterstützen uns dabei rauszugehen und Yoga im Alltag zu leben.
Yoga bedeutet Einheit, beziehungsweise das Ziel von Yoga ist Einheit und Erleuchtung. Es gibt verschiedene Yogawege, um dieses Ziel zu erreichen. Einer davon ist Rāja Yoga, das königliche Yoga. Dieser Weg basiert auf dem achtgliedrigen Pfad des indischen Philosophen Patañjali. Der dritte Punkt auf diesem Pfad ist Āsana, die Körperhaltungen, die wir in typischen Yogastunden üben. Doch der erste Punkt auf diesem Pfad ist Yama. Yamas sind Verhaltensregeln im Umgang mit anderen Lebewesen und der Umwelt. Das bedeutet, als aller erstes geht es darum, wie wir uns anderen gegenüber aktiv verhalten. Es geht also nicht in erster Linie um uns selbst. Yoga findet also nicht nur auf der eigenen Matte statt, sondern auch im Außen, im Alltag, im wahren Leben.
Der erste Punkt der Yamas, also die erste Verhaltensregel, ist Ahiṃsa. Ahiṃsa bedeutet Gewaltlosigkeit. Du wirst also dazu aufgefordert anderen Lebewesen und der Umwelt keinen Schaden zuzufügen. Weder in Gedanken, Worten, noch in Taten. Das beinhaltet auch gewaltlos einzugreifen, wenn du Gewalt in Worten und Taten – ausgeübt durch andere – beobachtest.
In der Yogaszene setzen sich viele für den Tier- und/oder Umweltschutz ein. Wir ernähren uns zum Beispiel vegetarisch oder vegan, transportieren unsere Einkäufe mit Jutebeuteln statt Plastiktüten und fliegen vielleicht nicht mehr von Frankfurt nach Berlin, sondern nehmen lieber den Zug. Anders ist es bei Rassismus und wenn es darum geht dieses Thema zu diskutieren und aktiv anzugehen. Viele sagen „Ich sehe keine Hautfarbe“, „Ich mache da keinen Unterschied“, „Für mich sind alle Menschen gleich“, „Wir sind alle eins“, „Ich verspüre da keinen Handlungsbedarf meinerseits, denn ich bin ja nicht rassistisch“, „Ich konzentriere mich lieber auf Positives, denn so ziehe ich Gutes an“. Vielleicht fragst du dich jetzt, wo hier das Problem liegt?
Wir leben in einer Welt, in der wir aufgrund unserer Hautfarbe, Geschlechts, Sexualität, Religion, Körperform und anderen Merkmalen, unterschiedlich behandelt werden. Wenn eine weiße Person und eine Schwarze Person nebeneinander in Stuttgart auf der Straße laufen, erleben sie im selben Moment unterschiedliche Realitäten, denn sie sind unterschiedlichen Vorurteilen ausgesetzt. Auf dem Instagram Account @wasihrnichtseht seht ihr die Erlebnisse, die People of Color machen. Eine weiße Person macht diese Erfahrungen nicht und das nur aufgrund der Hautfarbe. Indem du also sagst, du siehst keine Hautfarbe, verschließt du die Augen vor der Lebensrealität vieler Schwarzer Menschen. Du ignorierst so das Problem und förderst es sogar, da du nichts dagegen unternimmst. Indem du dich ausschließlich auf Positives fokussierst, umgehst du das Negative, schaffst es jedoch nicht aus der Welt. Dieses Verhalten wird Spiritual Bypassing genannt. Das fatale daran ist, dass so das Negative Raum bekommt und sich ausbreiten kann, da es nicht aufgehalten wird. Es ist also essenziell anzuerkennen, dass wir leider noch nicht alle gleich sind, und dass wir aktiv etwas unternehmen müssen, um irgendwann alle gleich zu sein. Und dass wir eben auch aktiv etwas tun müssen, um das Ziel von Yoga zu erreichen.
Yoga ist also politisch. Denn ein neutrales Verhalten würde bedeuten sich auf die Seite des Unterdrückers zu stellen. Ahiṃsa (Gewaltlosigkeit) wird nicht durch Neutralität, sondern durch spirituellen Aktivismus gelebt.
Wie können wir nun Yoga nutzen, um antirassistisch zu sein? Indem wir kraftvolle Āsanas, Körperhaltungen, üben, bauen wir nicht nur Muskeln auf, sondern stärken auch unseren Geist und unsere mentale Kraft, die wir brauchen, um aktiv zu sein. Durch das achtsame Üben der Asanas und das fokussierte Sitzen in Meditation, schaffen wir nicht nur Bewusstsein auf der Matte, sondern nehmen dieses Bewusstsein mit in den Alltag. Die eigenen Gedanken lernen wir so aufmerksam wahrzunehmen. Darüber hinaus nehmen wir auch unsere Umwelt bewusster wahr, wir erkennen Ungerechtigkeit schneller, können uns daraufhin tatkräftig einsetzen und Zivilcourage zeigen.
Indem wir üben unsere Herzen weit zu öffnen, entwickeln wir Mitgefühl allen Lebewesen gegenüber. Ob sie uns optisch ähnlich sind oder nicht. Ein kraftvolles Mantra, das uns dabei helfen kann ist Lokāḥ Samastāḥ Sukhino Bhavantu. Die Bedeutung dieses Mantras ist: Mögen alle Lebewesen glücklich und frei sein. Und mögen meine Gedanken, Worte und Taten in irgendeiner Form zum Glück und zur Freiheit aller Lebewesen beitragen. Ich möchte dich dazu ermutigen, dieses Mantra nicht nur in Yogastunden wahrzunehmen, sondern von der Matte mit in deinen Alltag zu nehmen und es zu leben, sodass wir irgendwann Einheit, das Ziel von Yoga, erreichen.
Text: Amuna Schmid