
Nein sagen. Wie wichtig ist es Grenzen zu setzen?
Texte:
Illustration: Lili Oberdoerfer
Prolog: Alexandra Zenleser, Zweiter Autor
Redaktion: Alexandra Zenleser, Alexandra Zenleser
Im Job, in der Partnerschaft, in Freundschaften oder einfach im Alltag. Wir möchten möglichst positiv erscheinen und dem Gegenüber zu jeder Zeit gefallen. Hierfür eignet sich doch eigentlich nichts besser als das kleine Wörtchen „Ja”. Wir stimmen anderen Menschen zu, geben uns unkompliziert und stellen unsere eigenen Bedürfnisse, wie selbstverständlich, hinten an. Wir erwecken dadurch den Eindruck, alles unter Kontrolle zu haben. Als wäre es easy noch ein Projekt nebenher zu stemmen, die Diplomarbeit der Freundin zu korrigieren, obwohl man bereits mit den eigenen Aufgaben um Wochen in Verzug ist oder wieder einmal einen unpassenden Kommentar des Nachbars schweigend hinzunehmen. Vielleicht kennen wir oftmals einfach keinen besseren Ausweg als Zustimmung, um unangenehmen Situationen aus dem Weg zu gehen. Das bedeutet nicht, dass es per se schlecht ist Ja zu sagen. Im Gegenteil, es kann uns bereichern unbekannten Menschen und Umgebungen offen gegenüberzutreten. Es kann uns neue Herausforderungen bringen und wunderbare Erfahrungen bescheren.
Vielleicht kommt es, wie mit so vielem im Leben, auf die richtige Balance an. Was also, wenn wir anfangen bewusster mit Zustimmung umzugehen? Wir sagen Nein zu Dingen, die wir nicht gut finden, nicht schaffen oder schlichtweg nicht möchten und treten der Welt trotzdem lebensbejahend gegenüber. Das neue Credo könnte lauten: Wir sagen manchmal Nein, weil wir Ja zu uns selbst sagen.
Tiefe und bewegende Einblicke in ihre Gedanken, persönlichen Erfahrungen und Entwicklungen gewähren uns Francesca Romana Audretsch, Franziska Zoe Grimm, Grischa Beuerle, und Nelesuta.

Ein Nein ist ein Ja zu dir selbst – eine Ode an die Selbstliebe
Mensch sein ist ein rhythmischer Strudel aus Routine, Verantwortung, Leidenschaft und Resilienz, den es immer wieder aufs Neue zu durchschauen gilt – insbesondere während einer andauernden Pandemie im vermeintlich modernen 21. Jahrhundert.
„Covid-19 hat uns ein Ansteckungsmodell geliefert.“ manifestiert der Soziologe und Philosoph Bruno Latour in einem Interview mit The Guardian. „Dieses Virus lehrt uns etwas. Wenn man sich von einem Mund zum nächsten verbreitet, kann man sehr schnell die ganze Welt anstecken. Dieses Wissen kann uns zu neuer Handlungsfähigkeit verhelfen.“ Aber von was oder wem lassen wir uns heutzutage anstecken? Was treibt uns an und womit möchten wir im übertragenen Sinne andere anstecken und mitreißen? Ein aktives Nein sagen zu staatlich sanktionierter Gewalt, der Beraubung von Menschenrechten und Menschenwürde hat sich beispielsweise die #blacklivesmatter Bewegung trotz Einschränkungen des Versammlungsrechtes nicht nehmen lassen. Demonstrationen gegen Polizeigewalt sind ein unabdinglicher Ausdruck des Nein sagens.
Wenn der Terminkalender so getaktet ist, wie der Sprechstil eines Eminem Rap Songs und das Durchatmen schwer fällt, hat man sich meistens etwas übernommen.
Wir dürfen nicht aufhören die Krise als eine Aufforderung für Veränderung zu begreifen und neue Grundlagen für eine freiheitliche Gesellschaft gemeinschaftlich zu entwickeln und kollektiv zu praktizieren. Die temporären Kontaktbeschränkungen, die im März 2020 in Kraft traten, zwangen uns alle unser Ja-sagen zu hinterfragen und vor allem: Nein zu vermeintlichen Selbstverständlichkeiten zu sagen, die ein aktives Einbringen der eigenen Person voraussetzen. Während dieser ungewissen Zeit ist auch ein Raum für ungewohnte öffentliche Diskurse entstanden und hat uns einmal mehr gezeigt, dass wir als Gesellschaft eine Epidemie der anderen Art auslösen könnten: eine der Fürsorge, Solidarität und Teilhabe. Wieso vergessen wir zu spüren, wann wir an unsere Grenzen kommen? Wir kommen ganz unterschiedlich an unsere Grenzen: Im kollektiven Arbeiten, beim eigenen Anspruch, ein nachhaltiges Leben zu führen oder solidarisch der Familie, den Freund:innen und anderen Gemeinschaften zu begegnen. Jeder Mensch hat unterschiedliche Bedürfnisse und kommuniziert auf unterschiedlichste Weise mit sich und seinen Mitmenschen.
Fürsorge ist ein Ausdruck zwischenmenschlichen Einander sehen und verstehen wollen. Man schaut aufeinander, begegnet einander, sorgt sich umeinander, weil man eine gesunde Gemeinschaft und ein lebensbejahendes Klima schaffen will.
Der Appell hieße in diesem Falle: Lasst uns gemeinsam Nein sagen. Ein nach vorne schauen bedeutet in meinem Fall auch ein auf mich schauen. Wo sind meine Grenzen? Dies lernte ich mit einem klaren Nein sagen, mitten in einer sogenannten „Coronazeit”, die doch von Fürsorge geprägt sein könnte, von einem Mitdenken und gegenseitigem Respektieren. In diesem Fall war es ein Nein zu sexualisierter Gewalt, ein Nein zu ungefragten Körperkontakt, ein Nein zu einem Unverständnis bei der Überlegung eine Anzeige zu schalten. Dieses Erlebnis ließ eine Wunde aufplatzen, die nicht richtig vernarbt ist und nur sehr langsam heilt. Mir wurde an jenem Morgen schlagartig bewusst, dass ich solch ein Verhalten nicht mehr bewältigen kann und möchte, denn meine persönliche Grenze wurde ganz klar überschritten. Der hybride Folgezustand aus Abwehrreaktion und Schockzustand des gerade Erfahrenen ist nur schwer auseinander zu zerren.
Ich werde immer wieder Nein sagen und mir wünschen, dass sich alle Menschen damit anstecken lassen. Erinnerungsblitze an ähnliche Situationen begleiten mich, versuchen ihre Wege zueinander zu finden, ein angefangenes Puzzle zu beenden, emotionalen Wellen Stand zu halten. Ohne die Fürsorge meiner engsten Mitmenschen könnte ich nicht weiter mutig Nein sagen, obwohl das ebenso überlebenswichtig sein kann, wie die Nein-sagen-Regelung aufgrund der Pandemie. Denn ein Nein zu anderen ist ein Ja zu mir selbst – ein auf mich achten und Sorge tragen.

Nein sagen. Wie wichtig ist es Grenzen zu setzen?
Es ist ein warmer Oktobertag. Die Sonne scheint ockerfarben durch das Blätterdach, das sich raschelnd über mir im Wind wiegt. Der schwere Kopf meiner Carne-Corso-Hündin liegt in meinem Schoß. Ich überfliege die Seiten eines Hundeführers.
Eigentlich halte ich nicht viel von solchen Tipps, da ich mich selbst doch eher als erfahrene Hundemama bezeichne. Der letzte Satz regt mich jedoch zum Nachdenken an. Das Kommando „nein“ sollte eher mit einem anderen Wortlaut wie „aus“ oder „pfui“ ersetzt werden, da wir „nein“ zu häufig in unserem Alltag benutzen. Das könnte unseren vierbeinigen Freund verwirren.
Meine Gedanken fangen an zu kreisen.
„Nein“. Handelt es sich hier wirklich um ein häufig benutztes Wort in unserem alltäglichen Gebrauch? Du kennst es mindestens genau so gut wie ich. Wie oft hast du zum abendlichen Caesar Salad genickt, obwohl du dir doch so viel lieber die 4-Käse-Pizza bestellt hättest, nur um deine Freundin nicht zu enttäuschen? Wie oft hast du dich breit schlagen lassen, hast deinen Kumpel auf irgendeine ätzende Geburtstagsparty begleitet, obwohl du doch so viel lieber mit einem Bier in der Badewanne gelegen hättest? Ich könnte noch ewig so weitermachen und etliche Beispiele aufzählen, doch am Ende des Tages tun wir diese Dinge doch nur, um unser Gegenüber nicht zu enttäuschen.
Wir vergessen dabei leider häufig die anderen 50%, welche die zwischenmenschliche Beziehung vervollständigt. Führen wir nicht mit uns selbst eine genauso tiefe, bedeutungsvolle Beziehung? Eine Beziehung, die sogar unser Leben lang dauert und von der wir uns niemals lösen können?
„Fehlende Grenzen schaden der Beziehung“ steht in meinem Hundeführer. Völlig egal, ob Vierbeiner oder Zweibeiner. Ob Familie, Freund:innen oder Arbeitskolleg:innen. Unsere zwischenmenschliche Beziehungen besteht zu 50% aus dir und zu 50% aus mir. Es ist okay, auch mal „nein“ zu sagen und für seine Seite einzustehen. Es ist okay, auf sich selbst manchmal ein bisschen mehr Acht zu geben und seine Bedürfnisse zu kommunizieren. Ich bin mir sicher, dass deine Freundin lächelnd zu einer 4-Käse-Pizza nicken wird und den Salat getrost in die Tonne kloppt.
Ich schrecke aus meinem Gedankenkarussel auf, weil ich bemerke, wie mein pelziger Gefährte genüsslich auf meinen Birkenstock Sandalen herumkaut. „Pfui“ rufe ich, springe auf, lache und mache mich auf den Weg nach Hause. Auf die Badewanne freue ich mich schon seit heute Morgen.
Text: Franziska Zoe Grimm

Über das Nicht-Wissen, Nicht-Ja-sagen und extra Mayo
Wer weiß, dass er nichts weiß, weiß mehr als die meisten, denn die glauben sie wissen, wobei sie in Wirklichkeit nichts wissen. Was du hier siehst ist kein Zungenbrecher. In diesem kleinen Satz versteckt sich ein noch viel kleinerer Satz und er soll dir zeigen, dass die Logik es von dir verlangt, dich erst deiner Grenzen bewusst zu sein, bevor du dich selbst ernst nimmst. Denn ganz gleich, ob du Grenzen setzt: Sie sind da.
Alles beginnt mit dem Satz: „Ich weiß, dass ich nichts weiß.“ Paukenschlag. Spannungsflimmern. Moment! Was soll das eigentlich überhaupt heißen und wer schwingt sich zu solch widersprüchlich anmutender Aussage empor? Nun, lass mich einfach ausholen, dich abholen und einholen und dich umpolen. Vom Wissenden zum Unwissenden und wieder zurück.
Die Wissenschaft schafft Wissen. Quizfrage: Welche Wissenschaft hat das Wissen selbst zum Gegenstand? Richtig! Die Epistemologie. Epistemolowas? Die Epistemologie ist ein alter verstaubter Weinkeller, der vielleicht mal Glanz und Glorie, nun aber nur noch Husten und fragende Gesichter beherbergt. Sie ist die Lehre des Wissens selbst. Was also, oh antiker Dinosaurier der Wissenschaft, ist denn genau „Wissen“? Platon oder Sokrates, also auf jeden Fall einer von den Beiden (man ist sich da nicht allzu sicher), sagt: „Eigentlich ist Wissen nichts zu wissen.“
Der Standart-Ratgeber aus dem schon lange durch multinationale Großkonzerninteressen gebeutelten Buchhändler deines Vertrauens sowie die ersten 576 Forumsbeiträge zu „Lerne dich selbst zu lieben“ und „23 Tipps für ein gesundes Selbstbewusstsein“ werden dir Ratschläge erteilen – wie beispielsweise, dass du dich um dich selbst kümmern sollst. Lass dich doch einfach mal nicht stressen! Koch mal was Feines! Nimm ruhig ’ne extra Mayo! Unterm Strich alles keine falschen Ansichten. Aber du wirst kein glücklicher Mensch werden, wenn du nur ganz viel Mayo dazu bestellst. Ungeachtet dessen fetzt Mayo.
Der historische Sokrates war der Überzeugung: Was uns heutzutage (also damals) öfter fehlt, ist jemand, der uns auf den Boden zurückholt und uns hinterfragt. Jemand, der dir sagt, dass der Pullover scheiße ist, weil Kinderhände aus Bangladesch darin stecken könnten und deshalb eben kein woker, sustainable citizen 2.0 bist. Jemand, der dir sagt, dass du mal von deinem Film runterkommen sollst.
Das Problem dabei ist, niemand wird das für dich tun. Und selbst, wenn es jemand tut, dann wirst du dieser Person nicht einfach beipflichten. Niemand kann dir so gut widersprechen, wie du selbst. Niemand kann fühlen, was du fühlst. Niemand kann dich ansatzweise so therapieren, wie du selbst. Denn da zwischen dir und mir, da ist ein unsichtbarer Grenzzaun. Und jede Grenzüberschreitung ist destruktiv, denn sie lässt unsere Identität verschwimmen. Diese aber gilt es zu festigen, wenn wir mit uns im Reinen sein wollen.
Diese Grenze müssen wir uns vergegenwärtigen und das ist der erste Schritt. „Ich weiß, dass ich nichts weiß.“ Das heißt zuallererst, was es aussagt – nämlich dass sich das nicht-wissende Subjekt über sein Unwissen gewahr wird. Damit weiß das unwissende Subjekt also irgendwie schon irgendwas, auch wenn das „was“ ein „nichts“ ist und damit faktisch irgendwie doch nicht so richtig „was“ ist. Es bedeutet, dass wir uns klarmachen sollten, dass wir gar nicht so viel wissen, wie wir uns manchmal einreden.
Von da aus sieht die Welt ganz anders aus: Wir sind keine gelabelten Student:innen, Sportler:innen und was noch. Wir sind Menschen, die keine Ahnung haben, ob das alles so richtig ist, was wir da tun, aber wir arbeiten dran. Und von da aus können wir Raum schaffen für die Liebe, für die Neugier und für extra Mayo.
Text: Grischa Beuerle
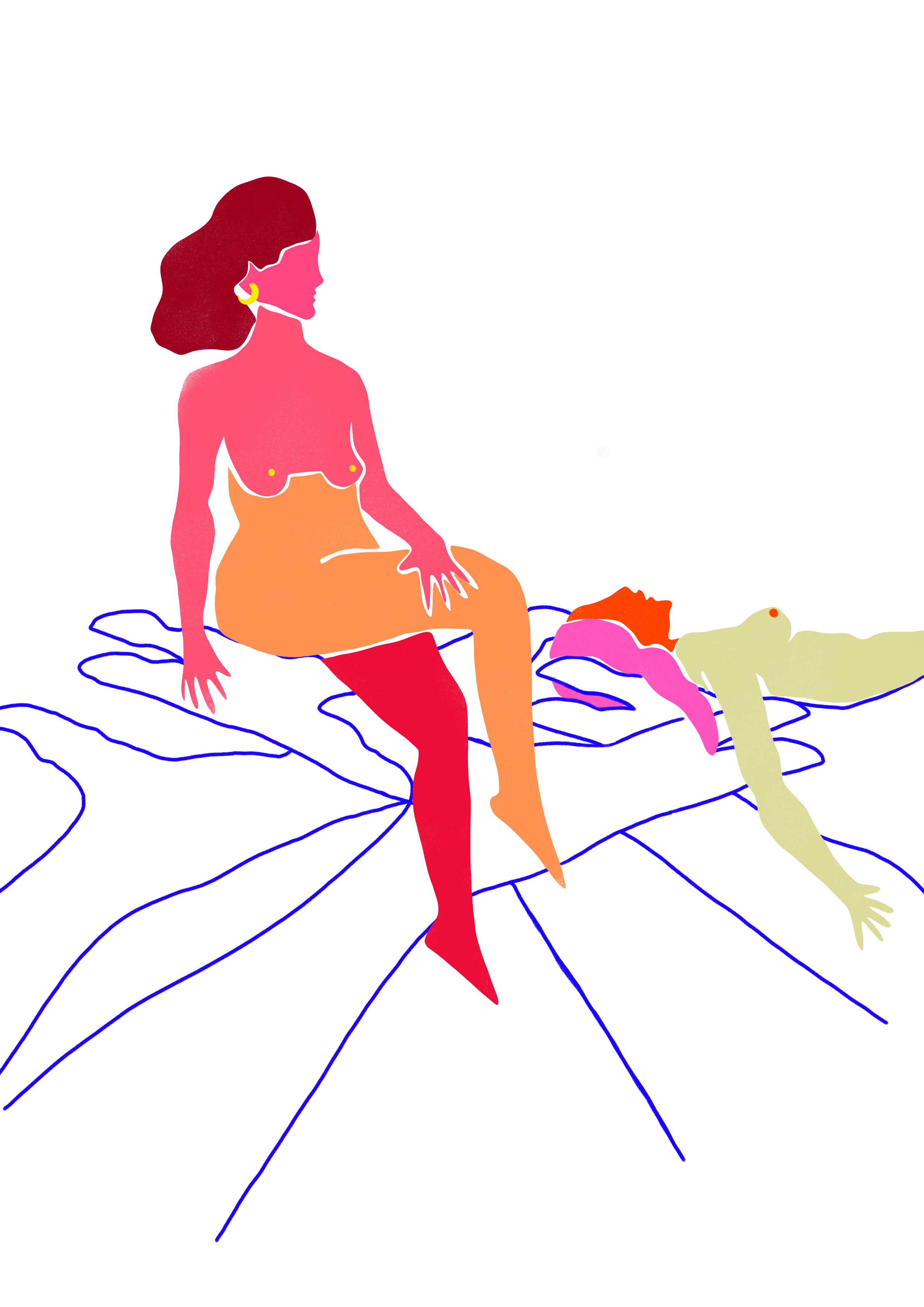
Nein, danke
Nein, danke.
Ich will meine Zeit nicht verschwenden.
Getragen werden von fremden Händen,
hoch hinaufsehen,
von hier werde ich nicht weggehen.
Nein, danke.
Ich will hierbleiben,
ich werde auch schweigen.
Den Moment nur genießen.
Nein, danke.
Lass mich ruhig alleine.
Nein, einsam bin ich nicht,
weil du immer in meinen Gedanken bist.
Text: Nelesuta