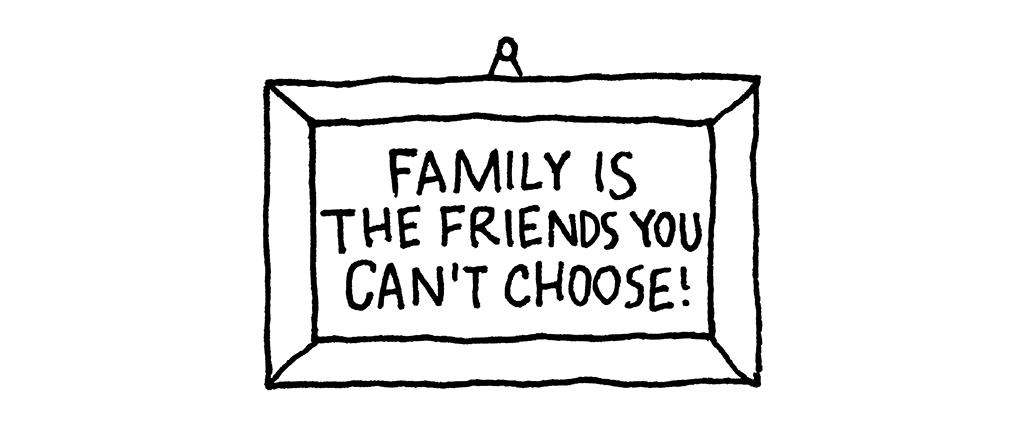
Familie
Texte:
Illustration: Ben El Halawany
Prolog: Alexandra Zenleser, Zweiter Autor
Redaktion: Alexandra Zenleser, Alexandra Zenleser
Eva Scholl, Luis Baltes und Lili Oberdörfer über Familie.
Ein Zuhause, Liebe, Zusammenhalt aber auch Verzicht, Verlust und Differenzen. All dies und mehr verbirgt sich hinter der Bezeichnung „Familie“. Ein Konstrukt, das uns in vielerlei Hinsichten prägt. Wir sind ein Teil von ihm und es umgekehrt eines von uns. Dabei ist Familie kein fester Begriff, sondern dynamisch und bunt in ihren verschiedenen Formen. Eltern, Geschwister, Verwandte, Lebensgemeinschaften, Kinder, Freundschaften oder Kollektive. Es ist das, was es für uns bedeutet.
In Familien treffen Meinungen, Generationen und Gefühle aufeinander. Kritik innerhalb dieses „Systems“, wie es Eva Scholl bezeichnet, zu äußern, bedarf Reflexion, Überwindung und Eigenständigkeit. Teil dieser Gemeinschaft und trotzdem frei im eigenen Denken und Handeln zu sein, ist ein Prozess, der sich bei jedem Familienmitglied ganz unterschiedlich äußert. Sehr still oder mit tosendem Lärm, durch Distanz oder Nähe, mit Humor oder Traurigkeit.
Jedes Familiengefüge ist einzigartig, so wie wir als Teil davon einzigartig sind.

Ich als ein Teil des Systems: meines Familiensystems.
Was bedeutet es, Kritik in einem System auszuüben, aus dem wir niemals austreten können?
Es ist die Rede vom Balanceakt unseres Selbst und unserer Identität in Beziehung zum System, welches uns – ob wir es wollen oder nicht – formt, berührt und sich in den Tiefen unseres Unbewussten manifestiert. Stelle ich mir die Frage nach Kritik innerhalb unseres Familiensystems, sehe ich die Hauptaufgabe von Kritik nicht darin zu bewerten oder Urteile zu fällen, sondern darin, das System der Bewertung selbst herauszuarbeiten, so wie der französische Denker Michel Foucault schon die Leistung der Kritik beschrieben hat. Warum jedoch sollte es wichtig sein, innerhalb seines Familiensystems Kritik zu üben? Es geht darum, eine Sichtbarkeit von Zuständen zu schaffen sowie über diese reflektieren zu können, um letztendlich andere Handlungsmöglichkeiten in Betracht zu ziehen. So stellt die Philosophin und Gendertheoretikerin Judith Butler in ihrem Essay über Foucaults Vortrag Was ist Kritik? folgende Frage: „Welches Verhältnis besteht zwischen Wissen und Macht, sodass sich unsere epistemologischen Gewissheiten als Unterstützung einer Strukturierungsweise der Welt herausstellen, die alternativen Möglichkeiten des Ordnens verwirft?“
Die Entwicklung der persönlichen Autonomie jedes einzelnen Familienmitgliedes empfinde ich daher als Bedingung für das Ausüben von Kritik innerhalb unseres Familiensystems. Autonomie bedeutet für mich die Fähigkeit zu besitzen, meine eigenen Handlungen und Entscheidungen treffen zu können. Es bedeutet für mich selbstbestimmt zu sein. Es ist wie eine Superkraft, die Fähigkeit zu besitzen zwischen dem zu differenzieren, was wir wollen und dem, was sich unsere Familie (wenn auch oft unbewusst suggeriert) wünscht. Damit einhergehend stellt sich folgende Frage: Gegen welche Regeln „verstoße“ ich innerhalb meines Familiensystems?
Nach dem Beenden der Schule wollte ich nur eines: weg von zu Hause. Ein neues Land, neue Menschen und eine neue Kultur kennenlernen. Ich ging für ein Freiwilliges Soziales Jahr nach Tel Aviv, zog danach zum Studieren nach Wien und lebe heute in Karlsruhe, mitunter um meine Familie aufgrund der räumlichen Nähe zu meiner Heimatstadt öfters sehen zu können. Damals ging es für mich darum, neue Erfahrungen zu sammeln und „die Welt zu sehen“ und mich ein Stück weit von meinem engsten Umfeld, meiner Familie, zu emanzipieren, mich ein Stück weit der lang ersehnten Autonomie anzunähern. Mit der Zeit merkte ich, dass ich mit diesem Versuch scheiterte mich meinem Wunsch, frei und unabhängig von den Gedanken, Konflikten und Meinungen meiner Familie zu sein, anzunähern. Ich spürte, dass es etwas anderes sein musste als die räumliche Distanz.
Was bedeutet es aber nun für mich autonom zu sein? Ich denke, es handelt sich um einen Prozess, der zunächst ambivalent erscheinen mag. Weil die einhergehende Bedingung zur Erlangung von Autonomie mit dem verbunden ist, wovor wir ursprünglich flüchten wollten: vor Bindung. Es geht darum, sich dem „System Familie“ anzunähern, sich selbst zu öffnen und mit den einzelnen Familienmitgliedern in Beziehung zu treten. Dazu gehört es, sich verletzbar zu machen und die eigenen Gefühle, Wünsche und Gedanken zu teilen. In Beziehung zu treten bedeutet ebenso, Konflikte zu führen, sich Zeit füreinander zu nehmen sowie Geduld zu haben. Es geht darum, Oma Gundula oder Onkel Peter zu erklären, warum mich Aussage XY wütend macht oder mit meinem persönlichen Verständnis der Welt nicht zusammenpasst.
Selbstverständlich ist es einfacher, sich physisch und emotional zu distanzieren, Konfrontation zu meiden statt in Beziehung oder Konflikte zu gehen – aber am Ende kommen wir nicht zum Ziel. Um autonom sein zu können, benötigen wir Nähe: körperliche und emotionale Nähe. Letztendlich bedeutet das, dass der Autonomie die Fähigkeit zur Bindung innewohnt. Diese Balance ist notwendig, um die Fähigkeit des Ausübens von Kritik zu erlangen, innerhalb des Systems, aus dem wir niemals austreten können.
Text: Eva Cathrin Scholl

Patch Work
Mein Vater hat mir mal durch die Blume gesagt, dass er seine Musikkarriere wegen mir aufgeben musste. Im ersten Augenblick klang das hart, ich hatte gerade ein Musikstudium abgeschlossen. Er meinte das aber nicht abwertend oder verletzend. Leicht wehmütig vielleicht, aber ich weiß er war stolz auf mich, dass ich den Weg einschlagen konnte, der ihm verwehrt blieb. Und vielleicht auch darauf, dass er in den Achtzigern die Entscheidung traf, statt einer professionellen Laufbahn als Gitarrist einen soliden Job angenommen zu haben um mich und zweieinhalb Jahre später meinen Bruder durchzufüttern. Er sagt sowas persönliches eigentlich immer nur, wenn er versucht, seine Gefühle auszudrücken. Deswegen blieb mir das Gespräch auch so gut in Erinnerung. Er ist nämlich ein Einzelgänger, der tief in seiner melancholischen Münchner Seele den Blues trägt. Das haben sowohl meine Mutter als auch später seine zweite Frau nicht lange ausgehalten. Die Bayern nennen das „Grant“ und zelebrieren das grummelige Unzufriedensein mal mit leicht lakonischem Humor, mal mit bitterem Bierernst. Mein Vater macht das gerne am Küchentisch mit der SZ in der Hand und dem Mittagessen auf dem Herd und schimpft leise über die Politik oder das Wetter. Dann kann man wunderbar mit ihm über Musik und den wilden Garten hinter dem Haus diskutieren. Er kocht leidenschaftlich gerne und muss das auch. Er hat aus zweiter Ehe vier junge Töchter – und er ist Witwer.
Als meine Stiefmutter nach kurzer Krankheit starb war das unglaublich schlimm für alle. Wir waren fassungslos und mein Vater stand vor der Situation, dass er im fortgeschrittenen Alter plötzlich alleine vier Teenager großziehen musste, die sich seit der Trennung ihrer Eltern bereits ein gutes Stück von ihm entfremdet hatten.
Er schafft das aber mit der Hilfe der ganzen Familie, ein paar Freunden und einer netten Nachbarsfamilie inzwischen sogar ziemlich gut. Väterlicherseits habe ich zwei Tanten, einen tollen Cousin, über den ich ein ganzes straßenkredibiles Rap-Album schreiben könnte, und eine stolze Cousine mit Mann und Kind.
Mein Bruder und ich wuchsen bei unserer Mutter auf. Ihr zweiter Mann war für uns ein wunderbarer Stiefvater, aber meine Mutter, eine begnadete Goldschmiedin, trägt eine Unabhängigkeit und eine Entschlossenheit in sich, mit der viele Männer aus ihrer Generation nicht gut umgehen können. Beide meiner Eltern sind also zweimal geschieden oder getrennt. Sie hat eine Woche nach ihrem Ruhestand freudestrahlend ein Kunststudium angefangen und malt seitdem fast jeden Tag ein bis drei Leinwände mit abstrakter Kunst voll. Sie wird immer besser und ihr Wohnraum immer kleiner. Alleinsein kann manchmal richtig beflügeln. Der Lockdown ist für sie eine willkommene Ausrede sich von der anstrengenden Gesellschaft, der sie jahrzehntelang in harter Arbeit den Vorzeigeschmuck schmiedete, endgültig abzukapseln. Sie hat nicht einmal mehr eine Katze.
Die Familie meiner Mutter ist für deutsche Verhältnisse riesig: Sie hat drei Geschwister, ursprünglich vier. Wir sind zehn Enkel und ein Urenkel. Die Großeltern, einer ihrer Brüder und der Mann meiner Tante sind leider bereits verstorben, aber ihre liebevolle Präsenz und ihre humanistischen Werte schwingen immer noch mit.
Einmal im Jahr gegen Sommer gibt es einen Familientag, bei dem sich alle Familienmitglieder irgendwo treffen und ein Wochenende lang viel trinken, viel essen und sich piesacken. Danach ziehen alle genervt und glücklich wieder ihrer Wege.
In der Familie meines Vaters mögen sie sich grundsätzlich eigentlich auch, aber so etwas anstrengendes wie einen jährlichen Familientag abzuhalten, noch dazu im Gegensatz zu Weihnachten völlig anlasslos, das käme weder ihm noch seinen beiden Schwestern jemals in den Sinn.
Die Scheidung meiner Eltern hat meinen Bruder damals etwas mehr mitgenommen als mich, aber er kommt mit Mitte Dreißig langsam darüber weg. Zutätowiert, Kunstfotografiestudium, Weltreisen, Berlin, tolle Freundin, kleine Wohnung, riesiges Herz.
Wir beide sind, wie unsere Eltern, die künstlerischen Ausreißer aus unseren hart arbeitenden hamburgisch-protestantisch, bayerisch-katholisch, rumänisch- und münchnerisch-agnostisch geprägten Familien.
Meine Mutter hatte meinen Vater beim Musizieren kennengelernt. Sie spielten in den frühen Achtzigern gemeinsam mit Freunden in Münchner Country-Bands – er als Gitarrist, sie als Sängerin. Sie war hübsch und muss so gut gewesen sein, dass sie sogar mal einen Plattenvertrag von einem dubiosen Schlagerproduzenten angeboten bekam. Die liefen damals über die kleinen Feste und durch die Clubs und signten schöne und talentierte Frauen, um sie in den unzähligen Dorfdiscos der Bundesrepublik zu verheizen. Wahrscheinlich habe ich ihr auch eine Musikkarriere verbaut. Vielleicht ist es aber auch besser so.
Text: Luis Baltes

Es ist endlich Wochenende. Die Ratten kriechen aus ihren Löchern, um sich auf einem alten Landhof zu treffen. Sie werden Tüten aufknabbern, sich im Holz verbeißen und anschließend Fressen finden.
Als die Großfamilie nach und nach eintrudelt, wird schnell ersichtlich, dass sich in dem alten Gasthof nicht ausreichend Betten für alle Anwesenden befinden würden. Bereits Monate vor dem Großfamilienwochende hatte Christa damit begonnen, in der letzten Ecke des Internets die preiswerteste Unterkunft für möglichst viele Personen aufzutreiben. Die Suche entwickelte sich dieses Jahr erneut zu einer lebenserfüllenden Beschäftigung, zum großen Leid ihrer Familie.
Christa transportierte einen Großkarton veganer Reismilch durch den Gang des Urlaubsdomizils. Wie bereits in den letzten Jahren, rührten weder ihre Schwester Rita noch ihr Bruder Emanuel einen Finger, um ihr zu assistieren. Dieses Jahr war es Christa erneut gelungen, den Preis des Urlaubes pro Person auf unter dreißig Euro zu minimieren. Von solchen Erfolgen lebte sie. Und sollte ihr verschnöselter Bruder noch einmal versuchen, die Finanzbilanz ihres Ausfluges durch unnötige Ausgaben zu manipulieren, würde das Folgen haben. Auf dem Familienwochenende wurde selbst gekocht, und zwar das, was über eine Doodle Liste abgestimmt wurde. Das war ihrem Bruder nicht recht. Kein Trüffel, kein Crémant. Bis heute war es Christa ein Rätsel, wie ihr Bruder aus den gleichen DNA- Bausteinen wie sie entstanden sein sollte. Für sie war er die Personifikation von Kapitalismus, eine Person, die, um das eigene Gewissen zu beruhigen, in ihrem Sportwagen ausschließlich Demeter-Lebensmittel transportierte. Dieses Auto, der weiße Jaguar F-Type, mit dem Emanuel vor drei Monaten bei ihren Eltern eingefallen war, der war ihr ein Dorn im Auge. Mit welcher Begeisterung ihr Vater damals um das Auto seines Sohnes kreiste, brachte sie zur Weißglut. Nicht nur ihr Bruder war also moralisch kompromittiert, sondern nun auch der Vater.
In diesem Moment meinte sie eine Stimme im Hof zu hören. „Christaaa, hallöchen!“ – das glockenhelle Lachen ihrer Schwester Rita hatte sie schon immer gestört, noch mehr als ihre stetigen astrologischen Ausführungen. Jetzt fehlte nur noch ihr Bruder Emanuel und dessen Familie. Schwer bepackt stapfte Rita durch den Gang in den Gemeinschaftsraum: „Ich brauche erstmal einen Kaffee, Mercury is in retrograde, you know“. Sie begab sich zu der im Eck stehenden Senseo Maschine. Für Rita eine große Enttäuschung, denn als Kaffeeliebhaberin war der Senseokaffee für sie nichts als braunes Wasser.
„Wunderschön dieses Haus, Christa, ganz toll ausgesucht!“ entzückte sich Rita, und säuberte ein ihrer Dreadlocks, die sich in ihre Kaffeetasse verirrt hatte. Ja hoffentlich, dachte Christa. Ihre Geschwister brachten stets die absurdesten Vorschläge an Reisezielen. Rita wollte in einem Wald campen, Emanuel hatte ein schweigendes Yoga-Retreat auf Bali vorgeschlagen. Das kam ihr nicht in die Tüte. „Ich habe Apfelstrudel von vorgestern mitgebracht“, säuselte Rita, „den könnten wir uns doch erstmal zur Stärkung genehmigen!“
Nachdem Emanuel verspätet eintrudelte, inklusive Assistentin und Dolmetscherin, klingelte sein Handy – ein Geschäftspartner aus China. Christa strafte ihn mit einem tödlichen Blick. Emanuel hingen die stetigen Großfamilientreffen zum Hals raus, kurz hatte er überlegt abrupt das Land zu verlassen, ein Jet stand stets bereit.
Christa hob das Glas: „Wie schön, dass wir alle zusammen sind!“
In diesem Moment krachte es ohrenbetäubend: Der weiße Jaguar F-Type durchbrach mit Vollgas die gläserne Verandatür des Landhauses. Das Auto krachte mit der Schnauze voraus in den Gemeinschaftsraum. Es klirrte und rumorte, bis endlich Stille eintrat. Der Apfelstrudel von vorgestern war um weitere Jahre gealtert. In den Überbleibseln des Sportwagens saß ihr Vater, und er blickte seinen drei Kindern erschrocken, aber genauso verschmitzt, in die Augen.
Text: Lili Oberdoerfer